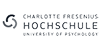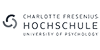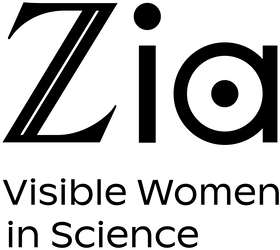Amelie Reigl / dieWissenschaftlerin: Interview
„Wer mit Freude dabei ist, erreicht Menschen ganz anders“

Amelie Reigl ist als Wissenschaftsinfluencerin auf Tiktok und Instagram erfolgreich
Amelie Reigl ist als @dieWissenschaftlerin auf TikTok und Instagram bekannt. Im Interview spricht sie über ihren Weg in die Wissenschaftskommunikation, wie man Social Media mit dem Forschungsalltag vereint – und warum man auch ohne Kameraausrüstung erfolgreich starten kann.
Aktualisiert: 12.05.2025
Amelie Reigl ist Doktorandin der Biologie im Bereich Tissue Engineering und Regenerative Medizin an der Julius-Maximilians Universität Würzburg. Unter dem Namen @dieWissenschaftlerin erreicht sie auf TikTok und Instagram tausende Menschen mit Videos über ihren Forschungsalltag, Wissenschaftsvermittlung und das Leben als Nachwuchswissenschaftlerin.
academics: Frau Reigl, warum sollten Wissenschaftler:innen Social Media nutzen?
Amelie Reigl: Ich finde, Wissenschaftler:innen haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag: Forschung zu betreiben, aber auch über diese Forschung zu sprechen. Und das funktioniert über Social Media sehr gut, weil man Menschen erreicht, die man auf Konferenzen nie treffen würde. Gleichzeitig finde ich aber auch: Nicht jede:r muss kommunizieren. Wer nicht vor die Kamera möchte, kann andere Formate nutzen. Wichtig ist, dass die Institute diese Vielfalt unterstützen. Deswegen finde ich's ganz, ganz wichtig, dass die Institute eine Plattform bieten und primär nach vorne gehen und die Wissenschaft der Forschenden wirklich kommunizieren und alle Wissenschaftlerinnen, die Lust haben, partizipieren können.
Sollte man sich als Wissenschaftler:in eher selbst oder die Forschung in den Vordergrund stellen?
Ich finde beides legitim. Forschung ist nie losgelöst von der Person, die sie betreibt. Wenn man sich zeigt, schafft dies Authentizität und Vertrauen. Aber wer lieber nur die Inhalte kommuniziert, kann das ebenfalls erfolgreich tun. Wichtig ist, dass man den Weg wählt, der zur eigenen Persönlichkeit passt.
Was waren Ihre wichtigsten Learnings auf dem Weg zur Wissenschaftsinfluencerin?
Man muss Spaß haben an dem, was man tut. Wer mit Freude dabei ist, erreicht Menschen ganz anders. Und: neugierig bleiben! Wissenschaftskommunikation lebt davon, neue Ideen auszuprobieren. Die Formate und Themen entwickeln sich weiter, und damit auch der Kanal. Das ist zwar Arbeit, aber auch eine kreative Chance.
Welche Plattformen eignen sich Ihrer Meinung nach am besten für Forschende?
Das kommt ganz auf die Zielgruppe an. LinkedIn ist super, wenn man sich in der Fachcommunity vernetzen oder neue Jobperspektiven aufbauen möchte. Instagram eignet sich eher, um gesellschaftlich breiter zu kommunizieren. TikTok erreicht vor allem jüngere Leute, wird aber auch älter. Ich selbst war früher auch auf X (Twitter), bin da aber inzwischen nicht mehr aktiv. Entscheidend ist: Wer soll die Inhalte sehen? Danach würde ich die Plattform auswählen.
Gibt es typische Fehler, die man am Anfang vermeiden kann?
Ja: sich selbst zu viel Druck machen. Viele denken, man braucht ein Studio oder eine Kameraausrüstung. Aber ein Handy, gutes Licht – zum Beispiel Tageslicht – und ein klarer Gedanke reichen völlig. Und: nicht entmutigen lassen, wenn mal ein Beitrag nicht so gut ankommt. Die Reichweite schwankt. Klicks und Likes gehen mal hoch und mal runter – das ist komplett normal.
Wie gehen Sie mit Kritik oder sogar Hasskommentaren um?
Gerade zu Corona-Zeiten war das Thema groß. Ich habe viele Kommentare bekommen, auch von Querdenkenden. Manches kann man sachlich beantworten, aber nicht alles. Wichtig ist für mich: Ich bin damit nicht allein. Austausch mit Kolleg:innen, Freund:innen, auch professionelle Stellen wie das NaWik oder Plattformen wie scicomm-support.de helfen. Und manchmal hilft auch emotionale Distanz. Nicht jeder Kommentar im Netz ist so bedeutsam, wie er sich anfangs anfühlt.
Wie integrieren Sie Wissenschaftskommunikation in Ihren Alltag?
Ich habe inzwischen ein kleines Team, das mich unterstützt, vor allem bei Kooperationsanfragen. Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Am Anfang war das natürlich anders. Aber Social Media ist für mich auch Ausgleich zum Forschungsalltag – ein kreativer Teil meiner Woche. Inzwischen gehört es einfach dazu.
Was raten Sie Forschenden, die ohne großes Team starten möchten?
Einfach anfangen! Man braucht weder viel Technik noch sofort einen Redaktionsplan. Aber man braucht Lust, ein bisschen Mut und den Willen, dranzubleiben. Lieber regelmäßig und realistisch posten, als sich selbst überfordern.