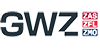Fürsorgepflicht im öffentlichen Dienst
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers: Was schließt sie ein?

Fürsorgepflicht: Der Dienstherr ist für die physische und psychische Gesundheit der Beamt:innen verantwortlich. © filadendron / iStock
In ihrem besonderen Arbeitsverhältnis haben Landes- und Bundesbeamt:innen auch einen besonderen Schutz: durch die Fürsorgepflicht ihres Dienstherrn. Wann greift sie, und welche Konsequenzen hat ihre Verletzung?
Aktualisiert: 24.08.2023
Definition: Fürsorgepflicht laut Beamtenrecht
Jeder Arbeitgeber – auch im privatwirtschaftlichen Bereich – hat eine Fürsorgepflicht zu erfüllen, die vor allem beinhaltet, dass er das Leben und die Gesundheit seiner Mitarbeiter:innen schützen muss. Im Beamtenverhältnis gibt es entsprechend eine Fürsorgepflicht des Dienstherrn: Sie ist in § 78 des Bundesbeamtengesetzes (BBG) für Bundesbeamt:innen und in § 45 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) für Landesbeamt:innen gleichlautend geregelt:
„Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl der Beamtinnen und Beamten und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er schützt die Beamtinnen und Beamten bei ihrer amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung.“
Wer ist der Dienstherr? Unterschied zum Arbeitgeber
Wichtig ist im Zusammenhang mit der Fürsorgepflicht zudem die Definition des Dienstherrn. Auch wenn der Begriff dem Arbeitgeber in der Privatwirtschaft entspricht, ist die Fürsorgepflicht bei Beamten und Beamtinnen weitaus umfangreicher ausgestaltet – beispielsweise gilt sie für die ganze Familie und über die Beschäftigungsdauer hinaus. Außerdem ist der Dienstherr keine natürliche, sondern eine juristische Person. Es handelt sich also um die jeweils vorgesetzte Dienstbehörde.
Gemeinden sind Dienstherren der Kommunalbeamt:innen, das jeweilige Bundesland ist der Dienstherr einer Lehrkraft und ein:e Professor:in untersteht je nach Bundesland entweder der Universität oder dem Land direkt. Bei den Landesbeamten und -beamtinnen ist der Dienstherr das jeweilige Bundesland, bei den Bundesbeamten die Bundesrepublik Deutschland: Soldat:innen sind also der letzteren unterstellt, Polizist:innen auf Landesebene (nicht Bundespolizei) dem Innenministerium eines Bundeslandes. Dienstherrn können daneben auch Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sein, die per Gesetz berechtigt sind, Beamte und Beamtinnen zu beschäftigen.
Fürsorgepflicht des Dienstherrn versus Treuepflicht des Beamten oder der Beamtin
Die im Bundesbeamten- und Beamtenstatusgesetz gewählte Formulierung „im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses“ beschreibt bereits eine Gegenseitigkeit – der Fürsorgepflicht des Dienstherrn steht also die Treuepflicht des Beamten gegenüber. Diese ist sogar im Grundgesetz (Art 33, Absatz 4) zu finden und hat somit Verfassungsrang. Dort heißt es: „Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.“
Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn und der Anspruch auf Fürsorge und Schutz stehen jedem deutschen Beamten oder Beamtin und seiner Familie zu, die Art des Beamtenverhältnisses spielt dabei keine Rolle. Personen, deren Verbeamtung nichtig war oder zurückgenommen wurde, sind dadurch jedoch nicht mehr geschützt.
Was beinhaltet die Fürsorgepflicht?
Zur Fürsorge zählt, dass der Beamte oder die Beamtin in gesetzlicher Höhe besoldet und auch im Ruhestand versorgt wird. Zur Fürsorgepflicht gehört beispielsweise auch die Sicherheit am Arbeitsplatz oder der Schutz vor Unfällen. Der Dienstherr muss gewährleisten, dass die psychische Gesundheit seiner Beamt:innen nicht gefährdet wird, er muss die Persönlichkeitsrechte wahren und die Privatsphäre schützen – darf sie also zum Beispiel nicht lückenlos überwachen. Auch der Schutz vor Mobbing oder Diskriminierung gehört zur Fürsorgepflicht.
Im Gegenzug für die Schutzmaßnahmen des Dienstherrn müssen Beamte Pflichten erfüllen: Sie sind im Bundesbeamtengesetz (für Beamt:innen des Bundes) und im Beamtenstatusgesetz (für Beamt:innen der Länder und Kommunen) recht ähnlich beschrieben. Zu den Pflichten gehört unter anderem, dass Beamtinnen und Beamte…
- … dem ganzen Volk, nicht einer Partei dienen.
- … sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen und für deren Erhaltung eintreten.
- … sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf widmen.
- … sich innerhalb und außerhalb des Dienstes dem Amt entsprechend verhalten.
- … die – soweit verordnete – Dienstkleidung tragen.
- … ihr Erscheinungsbild mit Rücksicht auf das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen gestalten (Schmuck, Tätowierungen, Haar- und Barttracht können eingeschränkt oder untersagt werden).
- … einen Diensteid leisten.
- … die Verschwiegenheitspflicht einhalten.
- … im Rahmen der Folgepflicht ihre Vorgesetzten beraten, unterstützen und deren dienstliche Anordnungen und allgemeine Richtlinien befolgen.
- … keine Belohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile in Bezug auf ihr Amt annehmen.
- … sich fort- und weiterbilden.
Bundesbeamtengesetz und Landesbeamtengesetz
Während das Bundesbeamtengesetz Rechte und Pflichten der Beamt:innen der Bundesrepublik Deutschland regelt, tun dies die Landesbeamtengesetze und das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) für die Beamt:innen der jeweiligen Bundesländer. Da das BeamtStG die Fürsorgepflicht des Dienstherrn und die Pflichten der Landesbeamt:innen regelt, unterscheiden sich diese zwischen den Bundesländern nicht. Die sonstigen Regelungen in den Ländern sind nicht identisch, aber sehr ähnlich. Die größten Unterschiede zeigen sich in den Bereichen Arbeitszeit, Selbstbeteiligung der Beihilferegelungen und den Jahressonderzahlungen.
Fürsorgepflicht des Dienstherrn: Wofür gilt sie?
Da im Gesetz nur formuliert ist, dass der Dienstherr „für das Wohl seiner Beamten sorgen muss“ nicht aber konkrete Einsatzfälle dafür definiert werden – gilt das Prinzip für sehr viele verschiedene Bereiche. Einige sollen hier beschrieben werden.
Fürsorge im Krankheitsfall
Da der Dienstherr verpflichtet ist, für das Wohl seiner Beamten und Beamtinnen zu sorgen, muss er dies natürlich und vor allem im Fall von Krankheit oder Pflegebedürftigkeit tun. Im Rahmen der Beihilfe erstattet er daher einen Teil der für die Behandlung anfallenden Kosten. Das Beihilfesystem ist ein eigenständiges Krankenversicherungssystem, ähnlich dem Arbeitgeberzuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitnehmenden. Wie diese sind auch Beamt:innen verpflichtet, zusätzlich selbst Vorsorge zu leisten – die Beihilfe ergänzt lediglich die zumutbare Eigenvorsorge.
Eine bundeseinheitliche Regelung der Krankheitsfürsorge gibt es nicht: Sie ist in der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) geregelt, in den meisten Ländern gibt es jedoch eigene Landesbeihilfeverordnungen, die sich teilweise von der BBhV unterscheiden. Zusätzlich resultiert aus der Fürsorgepflicht auch die Heilfürsorge: Diese erhalten Beamte und Beamtinnen, die – wie Mitarbeitende des Justizvollzugs oder der Polizei – während ihres Dienstes besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Die Krankheitskosten werden hier zu 100 Prozent übernommen (Beihilfe für Beamt:innen ohne Kinder meist 50 Prozent). Dem liegt zugrunde, dass sich die Betroffenen in diesen Bereichen aufgrund der erhöhten Risiken nur zu unzumutbar hohen Tarifen selbst zusätzlich krankenversichern könnten.
Bei einem Dienstunfall greift die Fürsorgepflicht des Dienstherrn dagegen nicht: Wird beispielsweise eine Bundesbeamtin oder ein -beamter im Dienst verletzt, wird die Unfallfürsorge nach § 30 Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) wirksam. Bundesbeamte und -beamtinnen sind nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung gemäß Sozialgesetzbuch geschützt.
Psychische Erkrankung: Pflichten des Dienstherrn
Wenn beispielsweise wegen einer psychischen Krankheit wie Burnout oder Depression der Amtsarzt aufgesucht wird, gebietet es die Fürsorgepflicht, dass dieser zur Ergänzung oder Bestätigung seiner eigenen medizinischen Einschätzung eine weitere fachliche Stellungnahme einholt, um den Gesundheitszustand des Beamten oder der Beamtin umfassend abzuklären. Grundsätzlich umfasst die Fürsorgepflicht, dass der Dienstherr psychischen Erkrankungen oder auch vorübergehenden seelischen Unausgeglichenheiten achtsam begegnet.
Fürsorgepflicht bei Mobbing und Shitstorms
Bei Umständen wie Mobbing, das zu psychischen Beeinträchtigungen führen kann, erstreckt sich die Fürsorgepflicht des Dienstherrn auch auf den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts einer Beamtin oder eines Beamten vor verletzenden Angriffendurch Vorgesetzte und andere Mitarbeitende.
Das gilt auch für das Internet: Plattformen, auf denen beispielsweise Professor:innen bewertet werden können, aber auch soziale Netzwerke sorgen dafür, dass immer mehr Beamt:innen von „Shitstorms“ betroffen sind. Der Dienstherr – in diesem Fall je nach Bundesland die Universität oder das Land – darf sich im Rahmen der Fürsorgepflicht nicht daran beteiligen oder die Professorin oder den Professor durch Kritik an ihrer Amtsführung nach außen bloßstellen.
In einem solchen Fall einer durch Dritte geäußerten Kritik hat die Beamtin oder der Beamte einen Anspruch, gegenüber dem Urheber der Vorwürfe durch eine „Ehrenerklärung“ des Dienstherrn rehabilitiert zu werden. Da in § 45 BeamtStG ausdrücklich der Schutz „bei ihrer amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung“ beschrieben wird, kann sich der Dienstherr nicht auf freie Meinungsäußerung berufen, sondern muss vielmehr im Rahmen der Diskussion auf die Lehr- und Meinungsfreiheit verweisen. Er hat sich – jedenfalls außerhalb des strafrechtlich relevanten Bereichs – schützend vor die Beschäftigten zu stellen. Auch bei Lehrer:innen, deren Dienstherr immer das jeweilige Bundesland ist, gilt in gleicher Weise die Fürsorgepflicht für diesen Fall.
Urlaub ist Fürsorge
Um psychischen Beeinträchtigungen und Erschöpfung vorzubeugen, muss der Dienstherr dem Anspruch auf Urlaub seiner Beamt:innen nachkommen. Zur Erholung von der Arbeit müssen sie jedes Jahr eine längere Zeit unter Fortzahlung des Gehaltes von ihrem Dienst befreit werden.
Fürsorgepflicht gegenüber Menschen mit Behinderung
Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erstreckt sich auch auf den Umgang mit seinen schwerbehinderten Beschäftigten. So muss der Dienstherr bei einer „Verwendungsentscheidung“ – also der Entscheidung, welche Stelle der Beamte oder die Beamtin ausfüllen soll, – die persönliche und familiäre Situation in seine Überlegungen einbeziehen.
Fürsorge nach Ende des Dienstverhältnisses
Wie im Bundesbeamtengesetz und Beamtenstatusgesetz formuliert, gilt die Fürsorgepflicht für Beamt:innen und ihre Familien „auch für die Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses“. So darf es beispielsweise nicht passieren, dass die Witwe eines Beamten Sozialhilfe beantragen muss, wenn die vom Dienstherrn gezahlten Witwenbezüge und regulären Beihilfeleistungen die Kosten ihres Pflegeheims nicht decken – vielmehr muss er die Beihilfeleistungen in diesem Fall aufstocken.
Verletzung der Fürsorgepflicht: Rechtliche Konsequenzen
Was passiert jedoch, wenn der Dienstherr den beschriebenen Pflichten nicht nachkommt, die aus seiner Fürsorgepflicht erwachsen? Gemäß dem gesetzlichen Charakter dieser Pflicht können sich Beamt:innen bei Verletzung der Fürsorge auf rechtlichem Wege gegen den Dienstherrn wenden.
Der erste Schritt ist, zunächst die Erfüllung der Pflicht vor dem Verwaltungsgericht einzuklagen. Ist die Erfüllung nachträglich nicht mehr möglich, können Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld entstehen.
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Dienstherr sich bei Entscheidungen über eine Beförderung oder Versetzung nicht ausschließlich vom Leistungsprinzip des Art 33 Abs. 2 im Grundgesetz leiten lässt: „Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.“ Jeder Beamte hat also Anspruch darauf, ermessensfehlerfrei befördert zu werden. Geschieht dies nicht, kann der Beamte oder die Beamtin eine Konkurrentenklage einreichen. Ähnlich ist die Lage in Bezug auf eine Benachteiligung bei der Einstellung oder bei unrechtmäßiger Entlassung.
Mobbing: So geht man vor, wenn die Fürsorgepflicht verletzt wird
Wenn eine Beamtin oder ein Beamter in ihrem Dienstverhältnis schikaniert wird, kann sie beantragen, dass der oder die Vorgesetzte gegen das Mobbing einschreitet – er oder sie kann aber auch ihre Versetzung beantragen. Ansprechpartner ist immer der oder die direkte Vorgesetzte. Geht das Mobbing vom Vorgesetzten aus, sollte der oder die Betroffene den nächsthöheren Vorgesetzten ansprechen. Bleibt der Dienstherr (verkörpert durch den Vorgesetzten) untätig, kann er sich wegen Verletzung seiner Fürsorgepflicht schadensersatz- oder schmerzensgeldpflichtig machen – vor allem, wenn die Beamtin oder der Beamte durch das Mobbing erkrankt oder sogar dienstunfähig wird.
Der Schadensersatzanspruch richtet sich immer an den Dienstherrn. Die Kolleg:innen, die sich des Mobbings schuldig gemacht haben, haften nicht unmittelbar, der Dienstherr kann aber Abmahnungen aussprechen oder Versetzungen anordnen.
Wer Opfer von Mobbing im Dienstverhältnis wird, sollte auf Folgendes achten: Das Mobbing muss nachgewiesen werden. Die Beamtin oder der Beamte muss also alle erfolgten Handlungen und Aussagen konkret darlegen. Dazu empfiehlt es sich, ein Mobbingtagebuch anzulegen, in dem die Ereignisse mit Datum, den beteiligten Personen und weiteren Details notiert werden. Zusätzlich sollten Betroffene frühzeitig rechtlichen Rat einholen.