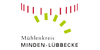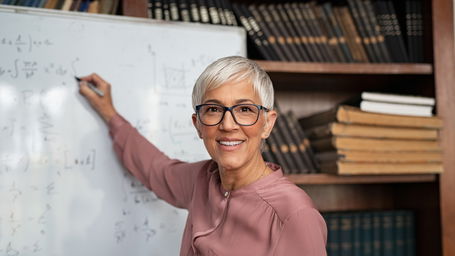Besoldung Beamte
Beamtenbesoldung: Wie hoch ist das Gehalt?

© Ridofranz / iStock.com
Wie hoch ist ein A13-Gehalt? Was ist die R-Besoldung, B-Besoldung oder W-Besoldung, und wie viel verdienen Beamte und Beamtinnen? Aktuelle Besoldungstabellen und Informationen über Besoldungsgruppen, Erfahrungsstufen und Zulagen.
Aktualisiert: 11.11.2025
Besoldungsrunde Bund 2025
Nach der Tarifeinigung im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) ist mit einer Übertragung des Ergebnisses auf Bundesbeamt:innen zu rechnen. Das würde bedeuten:
- 1. Januar bis 31. März 2025: Nullrunde
- 1. April 2025 bis 30. April 2026: Erhöhung um 3 Prozent, mindestens 110 Euro (rückwirkend)
- 1. Mai 2026, Ende offen: Erhöhung um 2,8 Prozent
Besoldungstabelle A (allgemein)
Die Besoldungsordnung A gilt für den überwiegenden Teil der Verbeamteten: vom einfachen über den mittleren und gehobenen bis hin zum höheren Dienst. Sie regelt zum Beispiel die Besoldung von Verwaltungsbeamten oder verbeamteten Lehrer:innen. Die Besoldungsgruppe A9 markiert dabei den Einstieg in den gehobenen Dienst, die Besoldungsgruppe A13 ist der Einstieg in den höheren Dienst.
A-Besoldungstabelle Bund: Grundgehälter (2025*)
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt min. (Stufe 1, in Euro, pro Monat) | Grundgehalt max. (Stufe 8, in Euro, pro Monat) | Bereich |
|---|---|---|---|
|
A3 |
2.706,99 |
3.046,42 |
einfacher Dienst |
|
A4 |
2.759,23 |
3.157,76 |
einfacher Dienst |
|
A5 |
2.778,44 |
3.259,46 |
einfacher Dienst |
|
A6 |
2.833,40 |
3.416,11 |
einfacher/mittlerer Dienst |
|
A7 |
2.963,97 |
3.684,10 |
mittlerer Dienst |
|
A8 |
3.123,39 |
3.982,32 |
mittlerer Dienst |
|
A9 |
3.354,26 |
4.283,30 |
mittlerer/gehobener Dienst |
|
A10 |
3.575,51 |
4.774,53 |
gehobener Dienst |
|
A11 |
4.056,80 |
5.299,72 |
gehobener Dienst |
|
A12 |
4.334,26 |
5.814,97 |
gehobener Dienst |
|
A13 |
5.046,30 |
6.427,89 |
gehobener/höherer Dienst |
|
A14 |
5.183,60 |
6.972,92 |
höherer Dienst |
|
A15 |
6.289,17 |
7.846,32 |
höherer Dienst |
|
A16 |
6.916,29 |
8.716,97 |
höherer Dienst |
*) gültig seit 1.3.2024, voraussichtlich rückwirkend zum 1.4.2025 Erhöhung um 3 Prozent
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion ©academicsBeamtenbesoldung in den Bundesländern
Die Bezüge auf Landesebene liegen grundsätzlich in einem ähnlichen Rahmen wie auf Bundesebene; jedoch gibt es große Unterschiede von bis zu 500 Euro brutto pro Monat. Am wenigsten verdienen dabei Beamtinnen und Beamte in den östlichen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, am meisten im Südwesten (Bayern, Baden-Württemberg). In den meisten Bundesländern werden die Grundgehälter zum 1. November 2024 um einen Sockelbetrag (häufig 200 Euro monatlich), zum 1. Februar 2025 nochmals linear angehoben, beispielsweise um 5,5 Prozent in Baden-Württemberg oder Bayern.
Die Besoldungstabellen A, B, W, R, C und AW der einzelnen Bundesländer finden Sie auf folgenden Seiten:
Baden-Württemberg (BW) • Bayern (BY) • Berlin (BE) • Brandenburg (BB) • Bremen (HB) • Hamburg (HH) • Hessen (HE) • Mecklenburg-Vorpommern (MV) • Niedersachsen (NI) • Nordrhein-Westfalen (NRW) • Rheinland-Pfalz (RLP) • Saarland (SL) • Sachsen (SN) • Sachsen-Anhalt (ST) • Schleswig-Holstein (SH) • Thüringen (TH)
Besoldungsordnung B: Besondere Ämter im höheren Dienst
Die Besoldungsordnung B regelt die Grundgehälter für besondere Ämter des höheren Dienstes, also für Spitzenbeamte und -beamtinnen. Hierunter fallen beispielsweise Leiter:innen von großen Behörden (wie etwa Oberbürgermeister:innen), Abteilungsleiter:innen in Ministerien, Botschafter:innen oder zum Teil auch Direktor:innen großer Schulen. Auch Dezernentinnen und Dezernenten in einer öffentlichen Verwaltung können je nach konkreter Funktion und Aufgabenbereich nach B-Besoldungsordnung vergütet werden.
Anders als in den anderen Besoldungsgruppen gibt es hier keine Stufen, sondern Festgehälter.
B-Besoldungstabelle beim Bund (2025*)
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (in Euro, pro Monat) |
|---|---|
|
B1 |
7.846,32 |
|
B2 |
9.080,76 |
|
B3 |
9.603,10 |
|
B4 |
10.149,51 |
|
B5 |
10.776,64 |
|
B6 |
11.372,63 |
|
B7 |
11.947,35 |
|
B8 |
12.548,95 |
|
B9 |
13.294,99 |
|
B10 |
15.612,33 |
|
B11 |
16.084,36 |
*) gültig seit 1.3.2024, voraussichtlich rückwirkend zum 1.4.2025 Erhöhung um 3 Prozent
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion © academicsBesoldungsordnung R: Richter und Staatsanwälte
Die meisten Richter:innen sowie Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sind bei den Ländern angestellt. Dem Bund dienen beispielsweise Richter:innen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundessozialgerichts, des Bundespatentgerichts oder des Bundesfinanzhofs.
Die Grundgehälter für Richter und Staatsanwältinnen richten sich laut Bundesbesoldungsgesetz nach den Besoldungsgruppen R1 bis R10. Der Aufstieg in die nächsthöhere Stufe (bis maximal Stufe 8) erfolgt in der Besoldungsgruppe R2 nach jeweils zwei Jahren, in den übrigen Besoldungsgruppen gelten Festgehälter.
R-Besoldung: Grundgehälter für Richter und Staatsanwälte (2025*)
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt min. (in Euro, pro Monat) |
|---|---|
|
R1 |
(weggefallen) |
|
R2 |
min. 6.086,73 (Stufe 1), max. 8.750,94 (Stufe 8) |
|
R3 |
9.603,10 |
|
R4 |
(weggefallen) |
|
R5 |
10.776,64 |
|
R6 |
11.372,67 |
|
R7 |
11.947,35 |
|
R8 |
12.548,95 |
|
R9 |
13.294,99 |
|
R10 |
16.084,36 |
*) gültig seit 1.3.2024, voraussichtlich rückwirkend zum 1.4.2025 Erhöhung um 3 Prozent
Quelle: Bundesministerium des Innern © academicsSchon gewusst?
Registrierte Nutzer:innen können kostenlos die Aufzeichnungen und Präsentationsfolien unserer Online-Seminare aus unserem Downloadbereich herunterladen. Zum Beispiel zum Thema „Karrierewege für Akademike:innen im öffentlichen Dienst“.
Besoldungsordnung W: Professoren und Professorinnen
Bis 2002 galt für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen die fünfzehnstufige Besoldungsordnung C; bis 2005 wurde sie schrittweise durch die Besoldungsordnung W mit drei Grundgehaltssätzen ersetzt. Ausführliche Informationen zur W-Besoldung von Professor:innen finden Sie in diesem academics-Ratgeber.
Grundgehalt Professor:innen (W-Besoldung), Bund
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt min. (in Euro, pro Monat) | Grundgehalt max. (in Euro, pro Monat) |
|---|---|---|
|
W1 (Juniorprofessor) |
5.524,76 |
– |
|
W2 |
6.812,67(Stufe 1) |
7.589,39 (Stufe 3) |
|
W3 |
7.589,39 (Stufe 1) |
8.625,02 (Stufe 3) |
*) gültig seit 1.3.2024, voraussichtlich rückwirkend zum 1.4.2025 Erhöhung um 3 Prozent
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion © academicsBesoldung: So setzt sich das Gehalt für Verbeamtete zusammen
Laut dem Bundesbesoldungsgesetz (§ 3 BBesG) haben Beamte und Beamtinnen Anspruch auf monatliche Besoldung, die jeweils im Voraus am Monatsersten ausbezahlt wird.
Der Dienstherr (also Bund, Land oder Kommune) ist gemäß den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums nach Art. 33 Abs. 5 GG verpflichtet, die Beamt:innen und ihre Angehörigen in amtsangemessener Höhe und auf Lebenszeit zu alimentieren. Verbeamtete im öffentlichen Dienst sollen ihre gesamte Arbeitskraft dem Staat zur Verfügung stellen können, ohne finanzielle Schwierigkeiten fürchten zu müssen. Die Höhe der Besoldung hängt deshalb nicht nur vom jeweiligen Amt und Dienstherr (Kommune, Land, Bund), sondern beispielsweise auch vom Familienstand ab.
Die Bezüge von verbeamteten Staatsdienern setzen sich aus dem Grundgehalt und möglichen Zulagen, Sonderzahlungen und Prämien zusammen. Mehr zu den Zuschlägen lesen Sie weiter unten im Text unter „Beamtenbesoldung: Grundgehalt und Zuschläge“.
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen und Anwärter) erhalten Anwärterbezüge. Hierzu gehören der Anwärtergrundbetrag, der Anwärtererhöhungsbetrag und die Anwärtersonderzuschläge. Auch der Familienzuschlag sowie vermögenswirksame Leistungen werden gewährt.
Erfahrungsstufen
Nach dem Bundesbesoldungsgesetz (§ 27 BBesG) erfolgt der Aufstieg in die nächsthöhere Stufe bei entsprechender Leistung
- in Stufe 1 nach einer Erfahrungszeit von zwei Jahren,
- in den Stufen 2 bis 4 nach jeweils drei Jahren und
- in den Stufen 5 bis 7 nach vier Jahren.
Grundgehalt bei Beamten: Besoldungsgruppen und Erfahrungsstufen
Das Brutto-Grundgehalt, das die Basis für die Besoldung bildet, bemisst sich nach der Besoldungsordnung (A, B, R oder W), in die der Beamte eingeordnet ist. Außer in der Besoldungsordnung B sowie in der Besoldungsordnung R ab Stufe R3, wo jeweils Festgehälter gelten, steigt das Grundgehalt entsprechend der „Erfahrungszeit“ von Verbeamteten stufenweise an.
Die Besoldungstabellen werden jährlich entsprechend der wirtschaftlichen Situation des Bundes, Länder und Kommunen angepasst und gesetzlich festgelegt.
Grundgehalt und Zuschläge
Wie oben bereits erwähnt, setzt sich die Besoldung aus dem Grundgehalt und diversen weiteren Bezügen zusammen: Aufgeschlagen werden der Familienzuschlag, Zulagen und Prämien, Vergütungen für Mehrarbeit, Leistungsbezüge (nur für Hochschullehrer:innen) sowie gegebenenfalls die Auslandsbesoldung, die Anwärterbezüge und vermögenswirksame Leistungen.
Der Familienzuschlag
Der Familienzuschlag richtet sich nach dem Familienstand sowie der Anzahl der Kinder. Seine Höhe ist im Bundesbesoldungsgesetz bzw. den Landesbesoldungsgesetzen festgeschrieben.
Bei Bundesbeamten und Bundesbeamtinnen erhält gemäß § 40 Abs. 1 BBesG den Familienzuschlag der Stufe 1 (153,88 Euro monatlich für Vollzeitbeschäftigte), wer
- verheiratet ist oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt,
- geschieden mit Unterhaltspflichten ist
- oder verwitwet ist (gleichzusetzen mit Personen, deren Partner:in aus einer eingetragenen Lebenspartnerschaft verstorben ist).
Ist der:die Ehe- oder eingetragene Lebenspartner:in des oder der verbeamteten Angestellten ebenfalls im öffentlichen Dienst tätig und hat Anspruch auf den Familienzuschlag der Stufe 1, wird jedem jeweils die Hälfte ausgezahlt. Bei Teilzeitbeschäftigung reduziert sich der Familienzuschlag entsprechend dem Anteil der Arbeitszeit.
Den Familienzuschlag der Stufe 2 erhalten Beamte und Beamtinnen mit Kindern, wobei sich der Zuschlag grundsätzlich aus dem Familienzuschlag der Stufe 1 und dem Kinderanteil für ein Kind zusammensetzt (285,40 Euro monatlich für vollzeitbeschäftigte Bundesbeamte). Bei weiteren Kindern erhöht sich der Familienzuschlag: für das zweite Kind um 131,52 Euro und für jedes weitere Kind um 409,76 Euro.
Sonderregelungen gibt es für die Besoldungsgruppen A3 bis A5. Hier erhöht sich der Familienzuschlag Stufe 2 für das erste Kind um 5,37 Euro. A 3-Beamte und -Beamtinnen erhalten zusätzlich für jedes weitere Kind 26,84 Euro, A4-Beamte 21,47 Euro und A5-Beamte 16,10 Euro.
Weitere Zulagen und Vergütungen für Beamte und Beamtinnen
Als weitere Zulagen, Vergütungen und Prämien sind unter bestimmten Umständen beispielsweise möglich:
- Amts- und Stellenzulagen gemäß § 42 BBesG
- Leistungs- und Prämienzulagen gemäß § 42a BBesG
- Prämien für besondere Einsatzbereitschaft gemäß § 42b BBesG
- Personalgewinnungs- und -bindungsprämien gemäß § 43 BBesG
- Zulage für die Wahrnehmung befristeter Funktionen gemäß § 45 BBesG
- Erschwerniszulage gemäß § 47 BBesG
- Mehrarbeitsvergütung (bezahlte Überstunden) gemäß § 48 BBesG
Beamtengehalt brutto und netto: Abzüge und Krankenversicherung
Anders als bei Angestellten im öffentlichen Dienst werden Beamt:innen von ihrer Besoldung keine Sozialversicherungsbeiträge – Renten-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung – abgezogen, sondern nur Steuern und die Beiträge zur Krankenversicherung.
Noch wechseln Verbeamtete meist in die private Krankenversicherung, da der Dienstherr hier Beihilfe zahlt, sich also zu einem gewissen Prozentsatz an Kranken-, Pflege- und Geburtskosten sowie an den Kosten für Medikamente oder Krankenhausaufenthalte beteiligt. Dadurch ist die private Krankenversicherung in der Regel für Beamt:innen die günstigere Alternative. In den meisten Bundesländern gibt es bisher nur diese Möglichkeit der individuellen Beihilfe, bei der die verbleibenden Kosten mit der privaten Krankenversicherung abgerechnet werden müssen.
Einige Bundesländer sind mittlerweile allerdings dazu übergegangen, auch Beihilfe zur gesetzlichen Krankenversicherung zu gewähren. Beamt:innen können dort alternativ die sogenannte pauschale Beihilfe wählen, die feste Beihilfesätze auch für die gesetzliche Krankenversicherung vorsieht. Die Abrechnung mit der Krankenkasse entfällt in diesem Fall, da die Kasse den Restbetrag, den die Beihilfe nicht abdeckt, direkt übernimmt.
Gemäß § 46 der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) gelten folgende Beihilfesätze (Stand 2024):
| Beihilfeberechtigte bzw. berücksichtigungsfähige Person | Beihilfesatz |
|---|---|
|
Beamt:in ohne Kinder oder mit einem Kind, für das der Familienzuschlag gezahlt wird |
50 % |
|
Beamt:in mit mindestens zwei Kindern, für die der Familienzuschlag gezahlt wird |
70 % |
|
Ehe- oder Lebenspartner:in |
70 % |
|
Kinder |
80 % |
|
Beamt:innen im Ruhestand (Versorgungsempfänger:in) |
70 % |
FAQ: Besoldung Beamte
Wie setzt sich das Gehalt von Beamtinnen und Beamten zusammen?
Das Gehalt (die Besoldung) setzt sich aus dem Grundgehalt, möglichen Zulagen (z.B. Familienzuschlag, Amtszulagen), Sonderzahlungen und Prämien zusammen. Die Höhe richtet sich nach der Besoldungsgruppe, Erfahrungsstufe, Familienstand und weiteren Faktoren wie dem Dienstherrn (also Bund, Land, Kommune).
Welche Besoldungsordnungen gibt es und für wen gelten sie?
Es gibt die Besoldungsordnungen A (allgemeiner Dienst), B (besondere Ämter im höheren Dienst), R (Richter:innen und Staatsanwält:innen) und W (Professor:innen). Die Einordnung richtet sich nach der jeweiligen Funktion und Laufbahn.
Wie hoch ist das Grundgehalt in den wichtigsten Besoldungsgruppen (Bund)?
Beispielhafte Grundgehälter (Stufe 1 bis 8, brutto/Monat):
- A9, mittlerer/gehobener Dienst: 3.354,26 € – 4.283,30 €,
- A13: 5.046,30 € – 6.427,89 €, gehobener/höherer Dienst
- B1: 7.846,32 € (Festgehalt)
- W2: 6.812,67 € (Stufe 1) – 7.589,39 € (Stufe 3)
Die genauen Beträge sind abhängig von Besoldungsgruppe, Erfahrungszeit und Bundesland. Die Bezüge werden voraussichtlich rückwirkend zum 1.4.2025 um drei Prozent, mindestens 110 Euro, angehoben.
Wie steigen Beamte in den Erfahrungsstufen auf?
Der Aufstieg in die nächsthöhere Erfahrungsstufe erfolgt regelmäßig nach festgelegten Zeiträumen und ist von der Leistung abhängig. Stufe 1 wird nach einer Erfahrungszeit von zwei Jahren erreicht, Stufe 2 bis 4 nach jeweils drei Jahren und Stufen 5 bis 7 nach vier Jahren.
Wie unterscheiden sich die Besoldungen zwischen Bund und Ländern?
Die Besoldungshöhen in den Bundesländern orientieren sich am Bund, können aber um bis zu 500 Euro monatlich abweichen. Anpassungen erfolgen regelmäßig durch Sockelbeträge oder prozentuale Erhöhungen.
Welche Abzüge gibt es bei der Beamtenbesoldung?
Von der Besoldung werden keine Sozialversicherungsbeiträge (Renten-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung) abgezogen. Es fallen lediglich Lohnsteuer und Beiträge zur Krankenversicherung an.
Wie funktioniert die Beihilfe zur Krankenversicherung für Beamte?
Der Dienstherr übernimmt einen Teil der Krankheitskosten (Beihilfe), zum Beispiel 50 Prozent für Beamte ohne Kinder, 70 Prozent bei zwei oder mehr Kindern. Der Rest wird meist über eine private Krankenversicherung abgedeckt.
Welche Rolle spielen Familienzuschläge bei der Beamtenbesoldung?
Familienzuschläge sind zusätzliche Zahlungen, die Beamt:innen erhalten können, wenn sie verheiratet sind oder Kinder haben. Die Höhe des Familienzuschlags variiert je nach Besoldungsgruppe und Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder. Dadurch soll die finanzielle Belastung für Familien ausgeglichen werden und das Einkommen von Beamt:innen mit Familienpflichten verbessert werden.
Wie werden Sonderzahlungen wie das Weihnachtsgeld für Beamt:innen geregelt?
Sonderzahlungen, zum Beispiel das sogenannte Weihnachtsgeld, sind nicht für alle Beamt:innen garantiert. Ihre Höhe und Auszahlung hängen von den jeweiligen Regelungen des Bundes oder der Länder ab. In einigen Bundesländern wurden Sonderzahlungen reduziert oder ganz abgeschafft, während sie in anderen noch Bestandteil der jährlichen Besoldung sind. Die genaue Regelung ist in den jeweiligen Besoldungsgesetzen festgelegt.
Welche Auswirkungen hat eine Beförderung auf das Gehalt von Beamt:innen?
Eine Beförderung führt in der Regel dazu, dass der Beamt:innen in eine höhere Besoldungsgruppe eingestuft wird. Dadurch erhöht sich das Grundgehalt und es können weitere Zulagen dazukommen. Außerdem beginnt mit der neuen Besoldungsgruppe häufig auch ein neuer Erfahrungsstufenlauf, sodass sich das Gehalt mit zunehmender Dienstzeit weiter steigert. Beförderungen sind somit ein wichtiger Faktor für die langfristige Gehaltsentwicklung von Beamten.