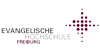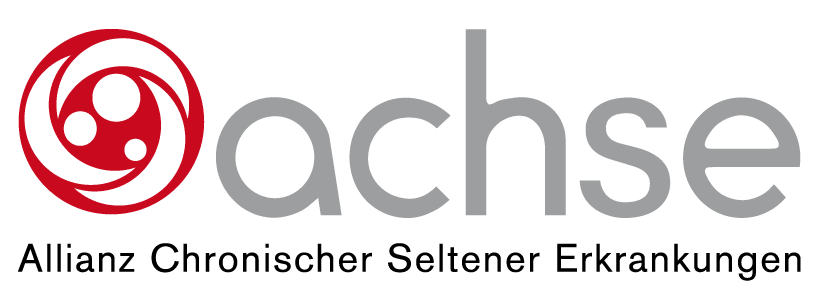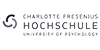Wissenschaftliche Arbeit
Wissenschaftliches Schreiben: Was guten akademischen Schreibstil ausmacht

Ein guter wissenschaftlicher Schreibstil ist essenziell für die akademische Arbeit. © Green Chameleon / unsplash.com
Wissenschaftliches Schreiben ist ein Handwerk, das Akademiker:innen beherrschen müssen. Für Studierende bedeutet das: die Regeln lernen und verinnerlichen.
Aktualisiert: 06.11.2023
Artikelinhalt
Was ist wissenschaftliches Schreiben?
Beim wissenschaftlichen Schreiben geht es um Verständlichkeit, Klarheit und Prägnanz in Ausdruck und Darstellung. Wichtige Voraussetzungen für gute wissenschaftliche Texte sind demnach sprachliche Präzision und anschauliches Darlegen von Fakten.
Absolvent:innen haben schon eine gewisse Erfahrung und Übung im Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten gesammelt. Für Studierende hingegen ist ein Regelwerk wichtig, das ihnen aufzeigt, wie eine Arbeit in Form, Struktur und Ausdruck gelingen kann.
Viele Studierende verklausulieren die Aussagekraft ihrer Texte, weil sie den wissenschaftlichen Schreibstil mit einer gewissen Schwere oder dem Aufzählen von Fachbegriffen und Fremdwörtern assoziieren. Doch das Gegenteil ist hier gefragt: je verständlicher, desto besser.
Kurzum: Es geht um Lesbarkeit. Aus dieser ersten Regel ergeben sich alle weiteren Regeln für einen guten wissenschaftlichen Schreibstil.
Zeitformen in der wissenschaftlichen Arbeit: Präsens oder Präteritum?
Bei wissenschaftlichen Arbeiten wird in der Regel das Präsens verwendet. Auch sollte dieselbe Zeitform den gesamten Text über eingehalten werden. Ein Wechsel ins Präteritum ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
Ereignisse aus der Vergangenheit etwa kann der Autor oder die Autorin im Präteritum beschreiben, um die zeitliche Abgrenzung zu heute zu markieren. Hier besteht jedoch die Gefahr, ins Erzählen abzudriften. So beschreibt es das Standardwerk „Arbeitstechniken Literaturwissenschaft“ von Burkhard Moenninghoff und Eckhardt Meyer-Krentler (19. Auflage 2022).
Darf die Ich-Form verwendet werden?
Zwar ist es wichtig, dass der Autor oder die Autorin die eigene Person aus einer wissenschaftlichen Arbeit zurückhält. Das bedeutet aber nicht, dass auf das „Ich“ gänzlich verzichten werden muss. Formulierungen wie „die Verfasserin will in dieser Arbeit aufzeigen, dass ...“ lesen sich oft umständlich. Aus der Ich-Perspektive zu schreiben, kann daher manchmal die bessere Alternative sein – auch das dient der Lesbarkeit.
Aktiv oder Passiv?
Der akademische Schreibstil ist unter anderem von der Fachrichtung abhängig und wie die Alltagssprache ist auch die Wissenschaftssprache im Wandel. War früher das Passiv noch das gängigere Verbgenus, werden wissenschaftliche Arbeiten heute eher im Aktiv verfasst. Eine strikte Vorgabe gibt es allerdings nicht. Vielmehr muss der Verfasser oder die Verfasserin versuchen, „die richtige Dosis an den korrekten Stellen“ zu finden, wie Günter Krampen, emeritierter Professor für Psychologie an der Universität Trier, rät.
7 Tipps für einen guten wissenschaftlichen Schreibstil
- Einfache, nicht verschachtelte Sätze
- Ausreichend Absätze
- Abwechslung in der Länge der Sätze
- Satzzeichen verwenden, um Zusammenhänge aufzuzeigen
- Fachterminologien kennen und möglichst sinn- und maßvoll einsetzen
- Substantivierungen, wenn möglich, vermeiden
- Richtig zitieren
Satzbau in wissenschaftlichen Texten: Konjunktionen und Füllwörter
Um die Lesbarkeit eines wissenschaftlichen Textes zu gewährleisten, ist ein übersichtlicher Satzbau essenziell. Je weniger Nebensätze ein Satz beinhaltet, desto einfacher ist er zu lesen. Wissenschaftler:innen sollten sich also immer, wenn ihnen ein Satz zu lang und komplex erscheint, fragen: Kann ich diesen Satz „entschachteln“? Diese Schachtelsätze entstehen, wenn komplexe Gedanken in sprachliche Form gebracht werden. An der Komplexität des Inhalts ist zwar nichts zu ändern, an seiner sprachlichen Darstellung jedoch schon.
Unvorteilhaft:Eine verbindliche Empfehlung für einen wissenschaftlichen Schreibstil auszusprechen, ist schwierig, denn dieser variiert von Fachrichtung zu Fachrichtung, was bedeutet, dass es keinen universellen wissenschaftlichen Schreibstil, den dennoch alle Studierenden beherrschen sollten, gibt.
Besser:Eine verbindliche Empfehlung für einen wissenschaftlichen Schreibstil auszusprechen, ist schwierig. Der Grund: Er variiert von Fachrichtung zu Fachrichtung. Das bedeutet, dass es keinen universellen wissenschaftlichen Schreibstil gibt. Dennoch: Alle Studierenden sollten den wissenschaftlichen Schreibstil beherrschen.
Die Abwechslung macht's
Das soll nicht bedeuten, dass es in wissenschaftlichen Texten keine langen Sätze geben darf. Im Gegenteil: Die Abwechslung zwischen langen und kurzen Sätzen wertet die Textqualität auf. Allerdings sollten Sätze nicht deshalb lang sein, weil sie aus unnötigen Wörtern bestehen. Daher stets prüfen:
- Gibt es Füllwörter, die für den Aussage des Satzes nicht notwendig sind?
- Sind alle Konjunktionen korrekt verwendet?
Oft lassen sich Zusammenhänge zwischen den Sätzen auch mit Satzzeichen statt einer Konjunktion herstellen. So kann beispielsweise ein Doppelpunkt ein „dass“ ersetzen – und aus einem langen Satz werden zwei kurze Sätze.
Gendern bei wissenschaftlichen Arbeiten?
In wissenschaftlichen Arbeiten kann gegendert werden. Verpflichtend ist das in der Regel aber nicht. Die Vorgaben und Empfehlungen beim Gendern variieren von Universität zu Universität, von Lehrstuhl zu Lehrstuhl. Entscheiden sich Autor oder Autorin der Arbeit für das Gendern, sollten sie sich für eine Variante entscheiden und diese einheitlich fortführen.
Möglichkeiten, in wissenschaftlichen Arbeiten zu gendern:
- Doppelform: Lehrer und Lehrerinnen (nur binär gegendert)
- Binnen-I: LehrerInnen
- Gender-Sternchen: Lehrer*innen
- Unterstrich: Lehrer_innen
Die einfachste Möglichkeit ist ein sogenannter Disclaimer zu Beginn der Arbeit:In der vorliegenden Arbeit wird auf die gemeinsame Nennung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum verwendet. Dieses impliziert das weibliche Geschlecht und dient der Lesbarkeit.
Schon gewusst?
Als registrierte:r Nutzer:in von academics bekommen Sie nicht nur passende Jobangebote – zum Beispiel Promotionsstellen – per E-Mail, wenn Sie das wünschen. Sie können auch den Promotions-Test absolvieren und herausfinden, ob eine Promotion für Sie der richtige Weg ist. Außerdem profitieren Sie von nützlichen Downloads und unseren kostenlosen Online-Seminaren zum Thema Karriere und Jobsuche.
Zahlen und Prozentzeichen: Ausschreiben oder nicht?
Es empfiehlt sich, das Prozentzeichen % sowie andere gängige Sonderzeichen wie $ oder € in wissenschaftlichen Texten auszuschreiben – mit Ausnahmen. Handelt es sich etwa um eine rechtswissenschaftliche Arbeit und das Sonderzeichen § kommt häufig vor, so kann es natürlich sinnvoll sein, dieses aus Platzgründen nicht auszuschreiben. Auch in tabellarischen Auflistungen bietet es sich an, Prozent- oder Eurozeichen nicht auszuschreiben, da es der Übersichtlichkeit dient.
Für Zahlen im Text galt lange: bis 12 ausschreiben, Zahlen ab 13 werden in Ziffern geschrieben. Diese Regel gilt heute nicht mehr. Grundsätzlich dürfen laut Duden mittlerweile auch Zahlen bis 12 als Ziffer geschrieben werden. Auch in Tabellen sind Ziffern grundsätzlich meist sinnvoller. Wichtig ist bei der Schreibweise von Zahlen und Sonderzeichen die Einheitlichkeit.
Aufbau und Formalia einer wissenschaftlichen Arbeit
Den Rahmen für eine wissenschaftliche Arbeit bilden die Formalia und der Aufbau. Beides zusammen ist die Voraussetzung dafür, dass ein guter wissenschaftliche Schreibstil zur Geltung kommen und die Arbeit überhaupt anständig bewertet werden kann.
Der Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit
Für Seminar-, Bachelor-, Masterarbeiten oder Dissertationen gelten ähnliche Anforderungen, was den Aufbau anbelangt:
- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhänge
- Eidesstattliche Erklärung
Die Formalia einer wissenschaftlichen Arbeit
In einer wissenschaftlichen Arbeit sind unbedingt die Vorgaben für Schriftbild und Seitenlayout zu beachten. Für diese gibt es jedoch keine allgemeingültigen Richtlinien. Studierende und Promovenden sollten also immer beim zuständigen Lehrstuhl anfragen, um verbindliche Informationen hierüber zu erhalten. Die folgenden Richtwerte sind daher unverbindlich, wenn auch in der Praxis oft angewandt:
- Formatierung: Blocksatz
- Schriftgröße: 12
- Schriftart: Arial oder Times New Roman
- Quellenangaben: Die einzelnen Quellen finden sich in Form von Fußnoten am Ende der jeweiligen Seite. In einigen Fächern sind anstelle der Fußnoten auch Endnoten am Schluss der Arbeit gängig. Wird eine Quelle das erste Mal genannt, so ist eine vollständige Quellen- oder Literaturangabe vonnöten (Name, Vorname, Titel, Verlag, Jahr, Seitenzahl).
- Das gesamte Literaturverzeichnis ist in alphabetischer Reihenfolge an die Arbeit anzuhängen.
- Seitenränder: ≈ 2,5 cm
- Zeilenabstand: 1,5-fach