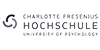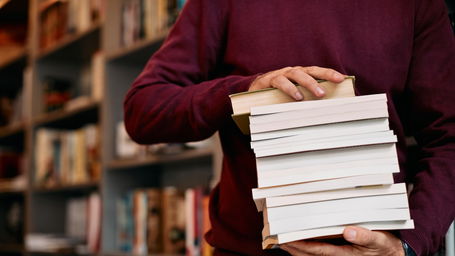Zitierregeln Wissenschaft
Richtig zitieren: Warum, wann und wie? Die Zitierregeln für wissenschaftliche Arbeiten von APA bis Harvard
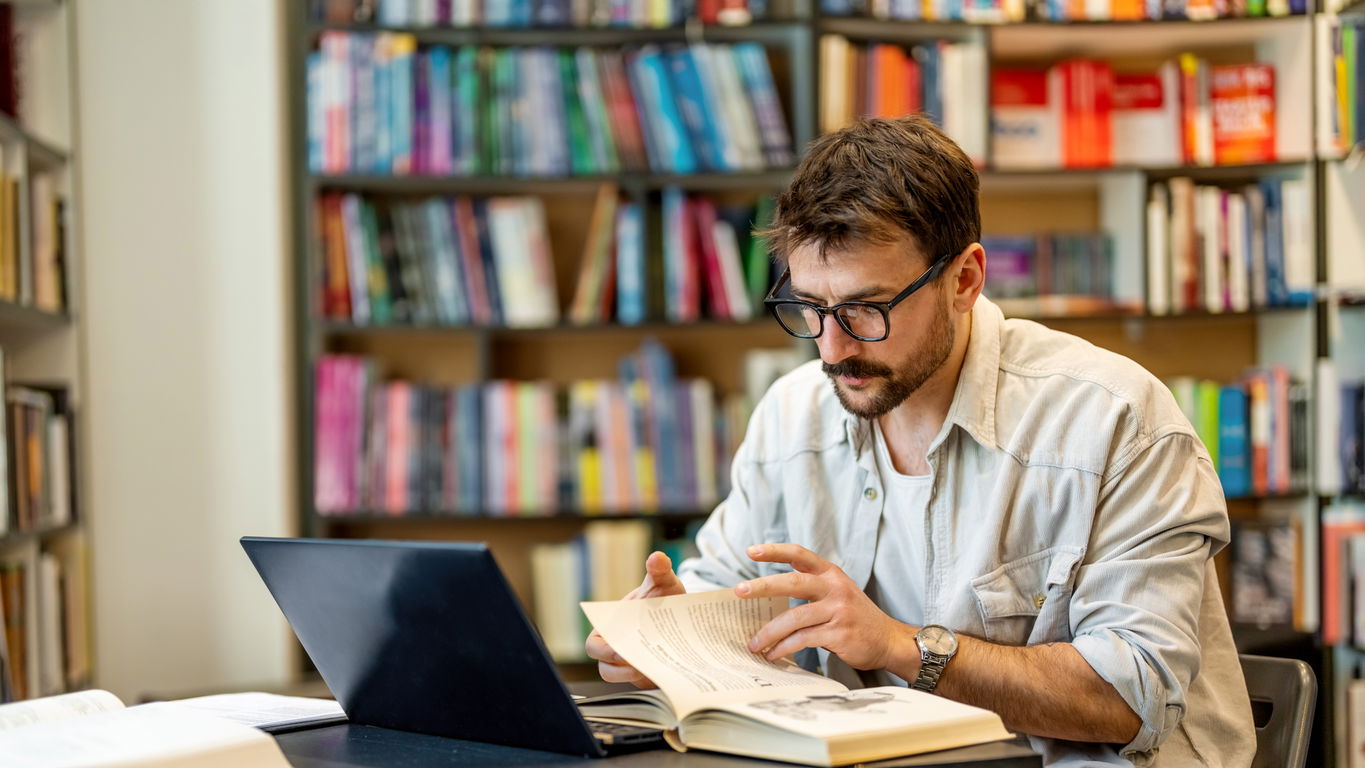
Wie zitiere ich wissenschaftlich korrekt? © ljubaphoto / iStock.com
Autoren und Autorinnen müssen vorangegangene Arbeiten auflisten, auf die sie sich beziehen. Was besagen die Zitierregeln nach APA, OSCOLA oder Harvard? Was bedeutet „et al“, und wie wird korrekt aus dem Internet zitiert? Der Überblick.
Aktualisiert: 07.05.2024
Was muss als Zitat gekennzeichnet werden?
Bei einer wissenschaftlichen Arbeit ist korrektes Zitieren essenziell, damit Sie nicht Gefahr laufen, des Plagiats beschuldigt zu werden. Es muss klar ersichtlich sein, welche Erkenntnisse, Forschungsergebnisse und Folgerungen von Ihnen stammen und wo Sie auf bestehendes Wissen zurückgegriffen haben.
Ob es sich um einzelne Begriffe, ganze Abschnitte oder auch eine Theorie handelt, auf die sie Bezug nehmen: Jedes Zitat und jede Paraphrase (sinngemäße Darstellung ohne Verfälschung des Inhalts) muss kenntlich gemacht und die Quelle angegeben werden – sowohl entweder als Kurzangabe in einer Klammer oder per Fußnote direkt hinter dem Zitat als auch ausführlich im Literaturverzeichnis.
Wichtig: Je nach Fachbereich werden verschiedene Zitierstile angewandt. Diese sind grundlegend sehr ähnlich, unterscheiden sich aber in Details. Einen Überblick über die Regeln der wichtigsten Zitationsstile liefert unten stehende Tabelle.
Internet: Zitieren von Quellen auf Webseiten und Social Media
Zitiert werden dürfen nur Quellen, die eindeutig auffindbar und überprüfbar sind. Eine Aussage Ihres Professors oder Ihrer Professorin während einer Vorlesung ist also nicht geeignet, wenn die Lehrveranstaltung nicht beispielsweise gefilmt und ins Internet gestellt wurde.
Webseiten
Bei Webseiten im Internet ist häufig nicht erkennbar, ob oder wann der Inhalt aktualisiert wurde. Zitieren Sie aus einer Onlinequelle, müssen Sie deshalb zwingend nicht nur die URL, sondern auch das Abrufdatum in der Literaturangabe vermerken. Wenn möglich, geben Sie statt der URL (kann sich ändern!) den DOI (Digital Object Identifier) an. Der DOI entspricht der ISBN-Angabe bei Büchern und ermöglicht eine eindeutige Identifikation. Auch hier gilt: Je nach Zitierstil gibt es Unterschiede bei der Darstellung des DOI, sh. unten. Beispielsweise bei Onlineausgaben von Fachzeitschriften wird der DOI in Regel angegeben.
Social Media
Zitieren Sie aus sozialen Medien wie Facebook, Instagram, X, BlueSky oder LinkedIn, müssen Sie den Nutzernamen, das Datum und die URL angeben.
Zitatformen: Direktes und indirektes Zitat
Sie können Zitate entweder wörtlich (direkt) oder sinngemäß (indirekt) in Ihre wissenschaftliche Arbeit einfließen lassen. Bei beiden Verwendungsarten gibt es einiges zu beachten. Lesen Sie im Folgenden die Regeln.
Direktes (wörtliches) Zitieren
Wenn Sie direkt zitieren, um beispielsweise eine Ihrer Thesen zu untermauern, muss dies exakt der Quelle entsprechend geschehen – also buchstaben- und zeichengetreu. Um kenntlich zu machen, dass es sich nicht um ihre eigenen Worte handelt, muss das direkte Zitat in Anführungszeichen gesetzt werden, und zwar in deutschen Abschlussarbeiten in der Regel in typografische („“). Die Quelle ist direkt dahinter zu nennen.
Nehmen Sie Änderungen wie Ergänzungen, Hervorhebungen oder Auslassungen vor, müssen Sie diese zwingend durch eckige Klammern (runde könnten Teil des Zitats sein, sodass nicht immer klar ersichtlich ist, ob es sich um eine Änderung handelt) kenntlich machen:
Auslassungen
Kennzeichnen Sie einzelne, ausgelassene Wörter durch [.], mehrere Wörter durch [...]. Auslassungen sind nur zulässig, falls Sie den Sinn des Satzes nicht entstellen.
Beispiel:
„Die Zitierregeln einzuhalten ist unter allen Umständen unumgänglich.“
Mit Auslassung:
„Die Zitierregeln einzuhalten ist [...] unumgänglich.“
Ergänzungen
Müssen Sie ein Zitat ergänzen, um den Zusammenhang klarzumachen, setzen Sie die Ergänzung ebenfalls in eckige Klammern.
Beispiel:
„Sie [Die Zitierregeln] einzuhalten ist unter allen Umständen unumgänglich.“
Hervorhebungen
Auch hier kommt die eckige Klammer zum Einsatz. Wollen Sie selbst ein Wort oder eine Passage in einem direkten Zitat durch Fetten, Unterstreichen oder kursive Schrift hervorheben, müssen Sie dies durch [Herv. d. Autors] oder [Hervorhebung des Autors] vermerken. Gibt es im Original eine Hervorhebung, die Sie nicht übernehmen wollen, muss auch das angegeben werden.
Beispiele:
„Die Zitierregeln einzuhalten ist unter allen Umständen [Herv. d. Autors] unumgänglich.“
„Die Zitierregeln einzuhalten [Herv. im Original] ist unter allen Umständen unumgänglich.“
Rechtschreibfehler
Fehler in Rechtschreibung oder Zeichensetzung im Original müssen Sie übernehmen – das gilt auch für veraltete Schreibweisen, beispielsweise vor der Rechtschreibreform 1996. Schwerwiegende Fehler, die eventuell die Bedeutung verfälschen könnten, müssen Sie mit [sic] (auch: [sic!] oder [!]) kennzeichnen, bei anderen Fehlern können Sie das tun (bitte Fakultätsregeln beachten, diese können abweichen).
Beispiel:
„Der Gefangene [sic] Floh.“
Durch das [sic] hinter „Gefangene“ wird ersichtlich, dass dieses Wort falsch geschrieben und also nicht von einem flüchtigen Gefangenen, sondern von einem gefangenen Floh die Rede ist.
Indirektes oder sinngemäßes Zitieren (Paraphrasieren)
Sie können den Inhalt, den sie zitieren wollen, auch in eigenen Worten wiedergeben. Üblicherweise nutzen Sie hier den Konjunktiv, also die indirekte Rede. Etwa: „XYZ ist der Ansicht, dass es unumgänglich sei, die Zitierregeln unter allen Umständen einzuhalten.“ Auch bei indirekten Zitaten oder Paraphrasen muss die Quelle direkt dahinter angegeben werden, allerdings wird hier ein „vgl.“ oder „vergleiche“ vorangestellt.
Schon gewusst?
Sie sind noch unschlüssig, ob Sie promovieren sollten? Finden Sie es heraus! Als registrierte:r Nutzer:in können Sie kostenlos den academics-Promotionstest machen, den wir gemeinsam mit dem Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg entwickelt haben.
Längere Zitate: So werden sie dargestellt
Wollen Sie Zitate einbringen, die über mehrere Zeilen laufen, werden diese üblicherweise eingerückt. In der Quellenangabe muss vermerkt werden, auf welcher Seite oder welchen Seiten das Original zu finden ist:
- S. 345: Das Zitat steht auf Seite 345.
- S. 345f.: Das Zitat beginnt auf Seite 345 und setzt sich auf Seite 346 fort.
- S. 345ff.: Das Zitat beginnt auf Seite 345 und erstreckt sich über mindestens zwei Folgeseiten.
In englischsprachigen Arbeiten ersetzen Sie „f“ durch „p“ und „ff” durch „pp”.
Die wichtigsten Zitierstile: APA und AMA Citation Style, Harvard-Richtlinien, MLA-Stil, deutsche Zitierweise
Keine Verfälschungen, penible, nachvollziehbare Quellenangabe: Die Grundregeln für korrektes Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten gelten fächerübergreifend und international. Dennoch greifen die unterschiedlichen Fachrichtungen auf verschiedene Zitierstile (auch: Zitationsstile) zurück, die sich vor allem in der Gestaltung der Quellenangabe unterscheiden. Im wesentlichen gibt es drei Systeme:
- Fußnoten-System: hochgestellte Zahl hinter dem Zitat, der Quellennachweis steht unten auf der Seite in der Fußzeile
- Autor-Datum-System: direkt hinter dem Zitat werden in Klammern der oder die Autor:innen und das Erscheinungsjahr genannt
- Numerisches System: Die Zitate werden durch fortlaufende Nummern gekennzeichnet, die Quellenangabe erfolgt lediglich im Literaturverzeichnis
Hinweis: Die im folgenden aufgeführten Beispiele für wichtige Zitierstile beziehen sich auf die direkte Zitation aus einem Buch (bei indirekten Zitaten stellen Sie ein „vgl.“ vor). Die Systematik ist auf andere Quellen wie Aufsätze, Zeitschriften, Internetseiten und Filme prinzipiell übertragbar. Die korrekte Vorgehensweise sowie weitere Regeln müssen Sie genau recherchieren. So erfolgt bei einigen Stilen die Nennung mehrerer Autoren durch „Erstautor et al.“ und bei mehrmaliger Verwendung derselben Quellen ist statt der ausführlichen die kurze Angabe „ebd.“ („ebenda“) zulässig.
Beachten Sie auch etwaige Sonderregelungen oder Stilvarianten, die Ihre Hochschule festgelegt hat – zum Beispiel kann die Zeichensetzung abweichen. Wichtig ist, dass die Zitierweise in der gesamten Arbeit einheitlich ist. Folgend eine Übersicht der wichtigsten Zitierweisen und ihrer Systematik.
Deutsche Zitierweise (Geisteswissenschaften):
Quellenangabe im Text: Fußnoten-System: hochgestellte Zahl hinter dem Zitat; unten auf der Seite der Quellennachweis: ¹Meier, Martin/Müller, Hans, 2018, Die Kunst des Zitierens. Hamburg: XY Verlag, S. 345
Quellenangabe im Literaturverzeichnis: ¹Meier, Martin/Müller, Hans, 2018, Die Kunst des Zitierens. Hamburg: XY Verlag, S. 345
DOI-Angabe: https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx
Harvard Referencing Style (Wirtschaftswissenschaften)
Quellenangabe im Text: Autor-Datum-System im Fließtext hinter dem Zitat: (Meier/Müller 2018, p. 345)
Quellenangabe im Literaturverzeichnis: Meier, Martin/Müller, Hans (2018), Die Kunst des Zitierens, 2. Aufl., Hamburg;
DOI-Angabe: doi: 10.xxxx/xxxxxx
APA – American Psychological Association (Psychologie, Sozialwissenschaften)
Quellenangabe im Text: Autor-Datum-System: (Meier & Müller, 2018, S. 345)
Quellenangabe im Literaturverzeichnis: Meier, M. & Müller, H. (2018). Die Kunst des Zitierens (Auflage). XY Verlag.
DOI-Angabe: https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx
MLA – Modern Language Association (Geisteswissenschaften, v. a. Sprachwissenschaften)
Quellenangabe im Text: Autor-Datum-System: (Meier & Müller, 2018, S. 345)
Quellenangabe im Literaturverzeichnis: Meier, Martin und Müller, Hans. Die Kunst des Zitierens. Hamburg: XY Verlag, 2018.
DOI-Angabe: DOI: 10.xxxx/xxxxxx.
AMA – American Medical Association (Medizin)
Quellenangabe im Text: Numerisch: Benennung durch fortlaufende Zahlen, z. B. (1) hinter dem Zitat
Quellenangabe im Literaturverzeichnis: 1. Meier M, Müller H. Die Kunst des Zitierens. Hamburg: XY Verlag; 2018
DOI-Angabe: doi:10.xxxx/xxxxxx
OSCOLA – Oxford Standard Citation of Legal Authorities (Rechtswissenschaften)
Quellenangabe im Text: Fußnoten-System: hochgestellte Zahl hinter dem Zitat; unten auf der Seite der Quellennachweis: ¹Martin Meier und Hans Müller, Die Kunst des Zitierens, (XY Verlag, 2018).
Quellenangabe im Inhaltsverzeichnis: Meier M und Müller H, Die Kunst des Zitierens (XY Verlag, 2018).
DOI-Angabe: nicht üblich
Chicago A (Geisteswissenschaften)
Quellenangabe im Text: Fußnoten-System: hochgestellte Zahl hinter dem Zitat; unten auf der Seite der Quellennachweis: ¹Martin Meier und Hans Müller, Die Kunst des Zitierens, (XY Verlag, 2018).
Quellenangabe im Inhaltsverzeichnis: Meier, Martin und Hans Müller. Die Kunst des Zitierens. Hamburg: XY Verlag, 2018.
DOI-Angabe: https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx
Chicago B (Geisteswissenschaften)
Quellenangabe im Text: Autor-Seiten-System: (Meier und Müller 2018, 345)
Quellenangabe im Inhaltsverzeichnis: Meier, Martin und Hans Müller. 2018. Die Kunst des Zitierens. Hamburg: XY Verlag.
DOI-Angabe: https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx
Turabian Fußnote (v. a. Geisteswissenschaften / Sprache)
Quellenangabe im Text: Fußnoten-System: ¹Martin Meier und Hans Müller, Die Kunst des Zitierens, (Hamburg: XY Verlag, 2018), p. 345.
Quellenangabe im Inhaltsverzeichnis: Meier, Martin und Hans Müller. Die Kunst des Zitierens. Hamburg: XY Verlag, 2018.
DOI-Angabe: https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx
Turabian Autor-Datum (v. a. Natur- und Sozialwissenschaften)
Quellenangabe im Text: Autor-Datum-System: (Meier und Müller 2018, 345)
Quellenangabe im Inhaltsverzeichnis: Meier, Martin und Hans Müller. 2018. Die Kunst des Zitierens. Hamburg: XY Verlag.
DOI-Angabe: https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx
Richtig zitieren: Was gilt bei Master- und Bachelorarbeiten?
Für das Verfassen einer Master- oder Bachelorarbeit gelten dieselben Zitationsregeln wie für jede andere wissenschaftliche Arbeit. Erkundigen Sie sich, welche Vorgaben Ihre Fakultät bezüglich des Stils hat.
Als Referenz sind Bachelor- und Masterarbeiten dagegen eher nicht geeignet, da sie in der Regel nicht veröffentlicht werden und somit die Quelle nicht zugänglich und nachvollziehbar ist – Sie sollten also nicht beispielsweise aus der Arbeit Ihres Kommilitonen zitieren, die er Ihnen zur Verfügung gestellt hat, da diese nicht für jedermann einsehbar ist. Selbst wenn die Arbeit in irgendeiner Form publiziert wurde, sind Zitate aus Bachelor- oder Masterarbeiten in der Regel dennoch nicht üblich. Dissertationen dagegen können Sie bedenkenlos heranziehen, da hier die Anforderungen und damit Standards höher sind.