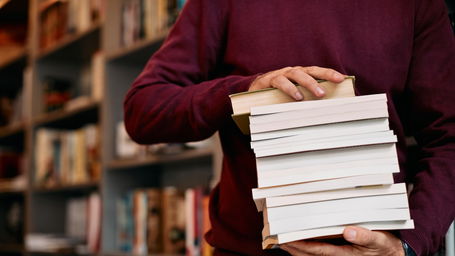Wissenschaftlicher Vortrag
Wissenschaftlicher Fachvortrag: Inhalt, Aufbau und Ziele

Wie gelingt ein guter wissenschaftlicher Vortrag? © FatCamera / istockphoto.com
Mit einem Fachvortrag stellt ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin aktuelle Forschungsergebnisse einem (Fach-)Publikum vor. Das kann die Reputation verbessern und die Karriere vorantreiben – wenn die Präsentation gut ist. Wie das gelingt und was die Besonderheiten wissenschaftlicher Fachvorträge sind, lesen Sie hier.
Aktualisiert: 20.10.2025
Was sind die Besonderheiten wissenschaftlicher Vorträge?
Ein wissenschaftlicher Fachvortrag unterscheidet sich von einem schulischen Referat oder einer Geschäftspräsentation in mehreren Punkten. Laut dem Springer-Verlag („Merkmale des wissenschaftlichen Vortrages. In: Der wissenschaftliche Vortrag“)
- wird ein Fachvortrag meist im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung gehalten, auf der Sitzungen zu verschiedenen Thematiken stattfinden
- gibt es eine:n Sitzungsleitende:n, der oder die Expert:in auf dem Fachgebiet und für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung verantwortlich ist
- gibt es eine vorher festgelegte Redezeit, die unbedingt einzuhalten ist
- gehören visuelle Hilfsmittel (zum Beispiel eine Powerpoint-Präsentation) und eine Diskussion zwingend zu einem wissenschaftlichen Vortrag dazu.
Des Weiteren ist zu beachten, dass Formalien wie der Aufbau, korrekte Zitate und die Quellenangaben ein großes Gewicht haben. Als Quellen dürfen – anders als beim schulischen Referat – keine Zeitungsartikel oder Wikipedia-Inhalte, sondern ausschließlich wissenschaftliche Publikationen genutzt werden.
Funktion eines Fachvortrags
Die Funktion eines Fachvortrags besteht zum einen darin, das anwesende (Fach-)Publikum über neue Forschungsergebnisse oder Methoden zu informieren. Zum anderen dient er der Profilierung des vortragenden Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin; er kann dessen Reputation verbessern und die Drittmitteleinwerbung erleichtern.
Im Prinzip gelten die Formalien auch für Vorträge von Studierenden an der Hochschule. Allerdings werden hier in der Regel nicht eigene Forschungsergebnisse vorgestellt, sondern Erkenntnisse zu einem bestimmten Thema prägnant und übersichtlich zusammengefasst („Leitfaden zur Erstellung wissenschaftlicher Präsentationen“, Dr. Till Förstemann, Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler, FU Berlin, 2020).
Beurteilt werden demnach nicht nur die Fachkenntnisse des Vortragenden, sondern auch die Art der Darstellung, das Engagement und die Einhaltung der Formalia. Weiter heißt es: „Eine gute wissenschaftliche Präsentation ist logisch aufgebaut, verständlich, sachlich und frei von Werturteilen.“ Das Niveau sollte dem des Publikums angepasst werden – es gilt, weder zu langweilen noch zu überfordern.
Vor der Ausarbeitung: Vorbereitende Überlegungen
Da die Präsentation einer wissenschaftlichen Arbeit große Relevanz für die Karriere haben kann, sollte für die Vorbereitung des Vortrags ausreichend Zeit eingeplant werden– mindestens zwei bis drei Wochen. Idealerweise ist er eine Woche vor dem Termin fertig, damit das freie Vortragen sowie die entsprechende Rhetorik und Gestik eingeübt werden können: Nur eine fesselnde wissenschaftliche Präsentation ist eine gute Präsentation. Zudem sollte mittels eines Probevortrags die Dauer überprüft werden. Wird der Zeitrahmen überschritten, darf keinesfalls schneller gesprochen, sondern es muss der Inhalt gekürzt werden.
Als vorbereitende Überlegungen empfehlen Förstemann und Löffler, vier Aspekte zu betrachten:
- Was genau will ich erzählen?
Der Vortrag muss eine ganz klare Aussage haben; eine etwaige Inhaltsleere oder Schwammigkeit darf nicht mit aufgebauschten Präsentationen überspielt werden. Hilfreich kann bei der Suche nach der exakten Fragestellung auch die gegenteilige Überlegung sein: Was will ich nicht erzählen? - Was will man von mir hören?
Es ist wichtig, sich Gedanken über das Publikum zu machen, das seine Zeit opfert, um dem Vortrag zu folgen. Handelt es sich um Studierende, ein Fachpublikum oder eventuell sogar fachfremde Zuhörer? Welche Inhalte erwartet das Publikum angesichts des angekündigten Themas? Wer A erwartet und B bekommt, wird vermutlich schnell gelangweilt, frustriert oder sogar verstimmt sein. - Wieso soll man mir glauben?
Damit die Zuhörenden überzeugt werden können, müssen sie die Inhalte verstehen – was nur gelingen kann, wenn auch der Vortragende das tut. Niemals sollten Sie über etwas sprechen, das Sie nicht selbst komplett durchdrungen haben. Schon allein deshalb, weil es Nachfragen geben könnte, die Sie beantworten müssen. Alle Aussagen, Daten und Zitate müssen zudem akribisch belegt werden – nennen Sie alle Quellen, auf die Sie sich beziehen (auch auf Schaubildern und Handouts). Stellen Sie keine Vermutungen an und wählen Sie eine klare, einfache Sprache ohne Schachtelsätze und unnötig viele Fremdwörter. - Passen meine Daten zu meinen Aussagen?
Achten Sie darauf, nur Daten zu präsentieren, die Ihre Aussagen exakt unterstützen und alle wesentlichen Aspekte berücksichtigen. Geht es beispielsweise um die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in einem bestimmten Staat, genügt es nicht, nur die aktuellen Bevölkerungszahlen mit der von vor zehn, 20, 50 Jahren zu vergleichen. Auch ihre Zusammensetzung spielt eine Rolle: Wie viele Männer gibt es, wie viele Frauen, wie ist die demografische Verteilung? Welche Faktoren – Klima, wirtschaftliche Situation, Bevölkerungspolitik, Kultur, Religion, Zustand des Gesundheitswesens et cetera – könnten die Entwicklung zudem beeinflussen? Stellen Sie die entsprechenden Daten vor.
Gliederung: Der Aufbau eines Fachvortrags
Der übliche Ablauf einer wissenschaftlichen Präsentation folgt dem Schema: Einleitung und Inhaltsverzeichnis – Hauptteil – Fazit/Ausblick. Vor Beginn des eigentlichen Vortrags begrüßen Sie das Auditorium und stellen sich kurz vor, im Anschluss an das Fazit folgt die Diskussion.
Einleitung
Die Einleitung sollte das Interesse der Zuhörenden wecken und sowohl das Thema als auch das Inhaltsverzeichnis vorstellen. Sie soll klar darstellen, was das Publikum erwarten kann. Eine provokant formulierte Eingangsfrage oder -these lässt aufhorchen.
Hauptteil
Im Hauptteil geht es dann darum, die in der Einleitung versprochenen Inhalte zu präsentieren. Stellen Sie Ihre Forschungsergebnisse und auch die angewandten Methoden vor. Belegen Sie alle Fakten mit den entsprechenden Daten. Ein roter Faden hilft dabei, das Interesse des Publikums konstant hochzuhalten.
Fazit/Ausblick
Im Fazit schließlich benennen Sie noch einmal die eingangs gestellte, zugrunde liegende Forschungsfrage und präsentieren die Antwort darauf kurz und knapp, eventuell mit Ausblick oder dem Hinweis auf weitere offene Forschungsfragen. Diese Zusammenfassung ist äußerst wichtig – der Anfang und das Ende eines Vortrags bleiben den Zuhörenden für gewöhnlich am besten im Gedächtnis.
Handout und Begleitmedien – Powerpointfolien und Co.
Essenziell für einen überzeugenden wissenschaftlichen Vortrag sind ein Handout und passende visuelle Begleitmedien, die Ihre Aussagen untermauern. Deren Vorbereitung nimmt ebenfalls geraume Zeit in Anspruch, die im Vorfeld eingeplant werden muss.
Das Handout, das vor Beginn der Präsentation ausgehändigt werden sollte, muss die wichtigsten Fakten und eine vollständige Quellenangabe unter Anwendung korrekter Zitierregeln enthalten. Auch ergänzende Informationen, die aus Zeitgründen beim Vortrag ausgespart werden, können hier aufgeführt werden. Immer genannt werden müssen auf dem Deckblatt Ort, Datum und Titel des Vortrags sowie der Name des Redners.
Als Begleitmedium werden häufig Powerpoint-Folien gewählt. Alternativ oder ergänzend können Plakate, eine Tafel, Film- und Audiodateien, Flipcharts oder ähnliches verwendet werden.
Tipps zur Gestaltung von Folien nach Förstemann und Löffler:
- Wählen Sie eine klare, schlichte Schriftart; die Schrift muss so groß sein, dass auch weiter hinten Sitzende den Text gut lesen können.
- Weniger ist mehr: Enthalten die Schaubilder viel Text, sind die Zuhörenden mehr damit beschäftigt, ihn zu lesen, als den mündlichen Ausführungen zu folgen.
- Hervorhebungen sollten durch Fettungen oder Kursivschreibung vorgenommen werden. Großbuchstaben sind schlecht zu lesen, Unterstreichungen sollten Internetlinks vorbehalten sein.
- Zahlen sollten sinnvoll gerundet dargestellt werden – 1.942.395,3685 Millimeter lassen sich nur schwer erfassen. 1.942 Meter oder 1,9 Kilometer sind bildhafter und besser verständlich.
- Aufzählungen sollten nur verwendet werden, wenn es keine kausalen Zusammenhänge gibt. Beispiel: Eine Firma möchte die Produktion steigern und den Marktanteil erhöhen. Was ist die Ursache, was die Folge? Werden die beiden Punkte als Stichpunkte mit Bulletpoints aufgeführt, ist das nicht ersichtlich – soll die Produktion einer Firma hochgefahren werden, um den Marktanteil zu steigern? Oder soll beispielsweise mittels Werbung der Marktanteil erhöht werden, worauf dann die Produktion gesteigert werden soll?
- Komplexe Zusammenhänge sind schwer zu erfassen, wenn sie in Häppchen serviert werden. Deshalb sollten zusammenhängende Informationen zu einem Thema auf einer einzigen Folie, nicht auf mehreren aufeinander folgenden präsentiert werden. Gegebenenfalls ist es sinnvoller, große Schaubilder auf einem Plakat darzustellen.
- Jede Folie sollte eine Überschrift haben und numerisch gekennzeichnet sein, damit die Zuhörer sich in der Diskussion klar auf sie beziehen können.
- Unabdingbar ist auch bei den Begleitmedien die korrekte und vollständige Angabe aller Quellen.
Tipps für einen gelungenen Vortrag
Da ein freier Vortrag zumeist fesselnder ist als ein abgelesener, sollten Sie keine schriftlich ausformulierte Rede, sondern lediglich Stichpunkte mit ans Rednerpult nehmen. Eine Ausnahme bilden Zitate, die Sie komplett notieren sollten, da diese vollständig und korrekt wiedergegeben werden müssen.
Tipp: Nennen Sie die wichtigsten Aspekte zuerst und machen Sie sich eine Notiz in den Unterlagen, an welchem Punkt drei Viertel der Zeit verstrichen sein sollten. Zeigt ein Blick auf die Uhr, dass Ihr Vortrag doch länger dauert als geplant, können Sie den Rest in abgespeckter, vielleicht sogar stichpunktartiger Form präsentieren. Die bahnbrechende Erkenntnis in der letzten Minute zu verkünden, mag ein toller Knalleffekt sein – der aber gewaltig nach hinten losgeht, wenn der oder die Diskussionsleitende Ihnen vorher das Wort entzieht.