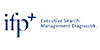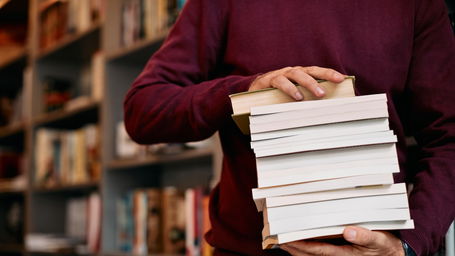Wissenschaftliche Präsentation
Erfolgreich vor Publikum: Tipps für die wissenschaftliche Präsentation

In den besten wissenschaftlichen Präsentationen trägt die visuelle Ebene etwas bei, was allein auf sprachlicher Ebene nicht ausgedrückt werden kann © izusek / istockphoto.com
Die Ergebnisse der eigenen Arbeit vor Publikum zu präsentieren gehört zum Alltag von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Folgendes sollten Sie bei wissenschaftlichen Präsentationen beachten.
Aktualisiert: 21.01.2022
Wissenschaftliche Präsentation: Darauf kommt es beim Vortrag an
In einem wissenschaftlichen Vortrag geht es darum, Informationen an die anwesenden Zuhörer und Zuhörerinnen zu übermitteln. Dabei sollen Daten, Fakten und Erkenntnisse so gestaltet und aufbereitet werden, dass sie das Interesse des Publikums wecken und die Kernaussagen im Gedächtnis bleiben.
Die Macht des Mediums
Mit der Einbeziehung von Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Overhead-Projektoren, Beamern und Powerpoint, ist als Ergänzung zum Vortragsmedium „Sprache“ zunehmend auch das Visuelle in den Fokus von Präsentationen gerückt. Fotos, Grafiken und Videos in den Vortrag einzubinden, wurde immer leichter und hat die Art und Weise, wie wir heute Informationen an ein Publikum herantragen, stark verändert. Mit der Vielzahl an visuellen Möglichkeiten können Präsentationen weitaus lebendiger und interessanter gestaltet werden. Im Idealfall erfüllt jedes Medium eine Funktion: Bilder können abstrakte Zusammenhänge manchmal besser veranschaulichen als es auf sprachlicher Ebene möglich ist. Die Stärke der Sprache dagegen ist das Erklären, Argumentieren, Bewerten.
Wer erfolgreich präsentieren will, entscheidet ausgehend von den zu präsentierenden Inhalten und dem Kenntnisstand des Publikums, welches Medium beziehungsweise welche Medien geeignet sind, um diese verständlich und anschaulich darzustellen. Diese Herangehensweise empfiehlt sich für eine Geschäftspräsentation ebenso wie für eine wissenschaftliche Präsentation.
Worin unterscheiden sich eine wissenschaftliche und eine Geschäftspräsentation?
Wissenschaftliche Vorträge werden etwa auf Fachkonferenzen, in Seminaren und Vorlesungen oder im Rahmen von Verteidigungen wissenschaftlicher Arbeiten, wie zum Beispiel einer Bachelorarbeit, gehalten. Im Gegensatz zu einer Geschäftspräsentation zeichnet sich eine wissenschaftliche Präsentation durch die folgenden Merkmale aus:
- Ziel: Information über Erkenntnisse und die zugrundeliegende wissenschaftliche Methodik (statt Entscheidungsfindung)
- Aufbau: Kernaussage steht als Folge der Ergebnisse am Ende (Trichter statt Pyramide)
- Abschluss: Diskussionsrunde
Für wissenschaftliche Präsentationen gilt außerdem, dass Quellen immer vollständig und korrekt angegeben werden müssen (wissenschaftliches Zitieren). Im Gegensatz zu Referaten in der Schule, wo auch Zeitungsartikel oder Wikipediaeinträge als Quelle zugelassen sind, dürfen in wissenschaftlichen Präsentationen ausschließlich wissenschaftliche Publikationen als Quellen herangezogen werden.
Ablauf der Präsentation: Von der Begrüßung bis zum Abschluss
Wie eine Präsentation im Detail aussehen und ablaufen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wo wird die Präsentation gehalten? Wer sitzt im Publikum? Wieviel Zeit steht zur Verfügung? Was ist das Ziel des Vortrags? Ausgehend von diesen Fragen lässt sich ein erster Rahmen für die Gestaltung des wissenschaftlichen Vortrags festlegen, auf dem die weitere Struktur aufbaut:
- Begrüßung
- Titel und Gliederung
- Einleitung
- Methodik und Ergebnisse
- Abschluss/Diskussion
Begrüßung
Zu Beginn Ihres Vortrags begrüßen Sie Ihr Publikum und heißen es zu Ihrem Vortrag willkommen. Befinden sich im Publikum Ihnen bekannte Personen, wie etwa Kolleginnen und Kollegen oder Mitstudierende, beziehen Sie sie in Ihre Begrüßung ein. So sprechen Sie Ihr Publikum auf einer persönlicheren Ebene an, als mit einem reinen „Sehr geehrte Damen und Herren“. Falls Sie einer Einladung gefolgt sind, beispielsweise zu einer wissenschaftlichen Tagung, empfiehlt es sich zudem, sich für diese beim Veranstalter zu bedanken. Berücksichtigen Sie auch mögliche internationale Gäste Ihres Vortrags mit einer zusätzlichen englischsprachigen Begrüßung.
Wichtig: Falls Sie zuvor nicht von einer anderen Person als Redner vorgestellt wurden, denken Sie im Anschluss an die Begrüßung daran, sich selbst kurz vorzustellen! Schließlich dient der Vortrag in nicht unerheblichen Maße auch ihrem Selbstmarketing als Wissenschaftler.
Titel und Gliederung
Stellen Sie Ihrem Publikum den (möglichst aussagekräftigen und prägnant formulierten) Titel sowie die einzelnen Gliederungspunkte Ihrer Präsentation vor. Bedenken Sie dabei auch die Erwartungshaltung Ihres Publikums: Falls Sie Ihr Thema bewusst abgrenzen und bestimmte Inhalte außen vor lassen werden, weisen Sie darauf hin.
Einleitung
Ausgehend von Ihrem vorgestellten Thema begründen Sie in Ihren nachfolgenden Einleitungssätzen, warum das Thema von aktuellem Interesse ist. Sie beschreiben zunächst die vorherrschende Situation, schildern anschließend das Problem und zeigen Chancen auf.
Methodik und Ergebnisse
Die Vorstellung der angewandten Methodik und Forschungsergebnisse bilden den Hauptteil Ihrer wissenschaftlichen Präsentation. Erläutern Sie Ihrem Publikum, wie Sie vorgegangen sind: Wie haben Sie Ihre Forschung geplant und vorbereitet? Wie liefen Datenerhebung und -Analyse ab, welche Methoden haben Sie dabei angewandt und warum? Wie wurden die Daten ausgewertet? Bei der Präsentation der Ergebnisse empfiehlt es sich, auf grafische Darstellungen zurückzugreifen, um die Informationen zu veranschaulichen.
Abschluss/Diskussion
Zum Abschluss Ihrer Präsentation greifen Sie noch einmal die Forschungsfrage auf und fassen die wichtigsten Aussagen und Ergebnisse zusammen. So sorgen Sie dafür, dass Ihrem Publikum die zentralen Informationen Ihres Vortrags im Gedächtnis bleiben. Falls die Rahmenbedingungen es zulassen, bieten Sie eine Frage- bzw. Diskussionsrunde an, in der Ihr Publikum die Möglichkeit hat, offene Fragen zu klären oder Anmerkungen zu Ihrem Thema zu machen.
Wie gestalte ich eine Präsentation interessant?
Gerade in wissenschaftlichen Präsentationen geht es häufig um sehr komplexe und teilweise trockene Sachverhalte. Diese müssen einem Publikum nicht nur innerhalb einer vorgegebenen Zeit, sondern auch möglichst interessant dargestellt werden. Schließlich wollen Sie als Wissenschaftler nicht nur, dass Ihre Botschaft bei der Zuhörerschaft ankommt, sondern auch Ihre Reputation mit einer erfolgreichen Präsentation stärken, die positiv im Gedächtnis bleibt. Damit Ihr Publikum Ihnen gerne zuhört, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:
- Roter Faden: Ihre Präsentation braucht eine Struktur, damit das Publikum Ihren Ausführungen folgen kann und gerne zuhört. Der rote Faden ist das Gerüst, das Ihren Vortrag zusammenhält.
- Einzigartigkeit: Jede Präsentation sollte ein Unikat sein. Schneiden Sie sie daher auf den jeweiligen Anlass, das Thema und das Publikum zu. Präsentationen, die lediglich aus anderen Präsentationen zusammenkopiert wurden, sind selten gut.
- Gestik und Mimik: Wenden Sie sich dem Publikum zu, stehen Sie stabil, bewegen Sie sich ruhig, blicken Sie Ihr Publikum an und nicht nur auf die Unterlagen. Unterstreichen Sie Ihre Worte mit der passenden Körpersprache. Aber: Bleiben Sie authentisch!
- Sprechtempo: Artikulieren Sie deutlich und sprechen Sie nicht zu schnell – das Publikum kann sonst eventuell nicht mehr folgen. Ein zu langsames Sprechtempo kann dagegen einschläfernd wirken, genau wie eine monotone Satzmelodie; bemühen Sie sich um angemessene Modulation, Dynamik und Rhythmik.
- Freies Sprechen: Ein freier Vortrag ist fesselnder als ein schriftlich ausformulierter, einstudierter. Greifen Sie als Hilfsmittel daher lediglich auf Stichpunkte zurück. (Eine Ausnahme bilden Zitate, die Sie komplett notieren sollten, da diese vollständig und korrekt wiedergegeben werden müssen.)
- Visualisierung/Präsentation: Setzen Sie visuelle Gestaltungsmittel nicht willkürlich ein, sondern so, dass sie Ihre Inhalte verständlich und anschaulich darstellen und Ihre Präsentation bereichern. Bedenken Sie dabei: Das Präsentieren ist nicht die Aufgabe von Powerpoint, sondern Ihre. Investieren Sie Ihre Zeit also lieber in den eigenen Vortrag, als in textlastige Folien.
Tipps für die perfekte wissenschaftliche Präsentation
Das A und O bei einer wissenschaftlichen Präsentation ist die richtige Vorbereitung. Mit einer sauberen und durchdachten Entwicklung und Planung Ihrer Präsentation stellen Sie sicher, dass während Ihrer Präsentation keine unerwarteten Hindernisse auftauchen. Weiterer positiver Nebeneffekt: Je besser Sie vorbereitet sind, desto weniger Grund gibt es, nervös zu sein.
Mit diesen 5 Tipps kann die perfekte Präsentation gelingen:
- Probevortrag: Halten Sie mindestens einen Probevortrag – am besten vor Publikum, zum Beispiel Freunden oder Kollegen, die Feedback geben können. Falls das nicht möglich ist, zeichnen Sie Ihren Vortrag auf. So üben Sie nicht nur das freie Sprechen, sondern wissen auch, wieviel Zeit Sie einplanen müssen.
- Veranstaltungsort kennen: Machen Sie sich im Vorfeld mit dem Raum und der dort vorhandenen Technik vertraut.
- Handling des Handouts: Bereiten Sie zusätzliches Material wie Handouts, rechtzeitig vor und notieren Sie sich vorab, wann Sie es verteilen wollen.
- Rechtzeitig eintreffen: Stellen Sie sicher, dass Sie rechtzeitig da sind, um Stress zu vermeiden.
- Gute Zeiteinteilung: Die zentralen Ergebnisse sollten zwar am Schluss stehen, aber verkünden Sie sie nicht in der allerletzten Minute. Sollte Ihr Vortrag doch länger dauern, als geplant, riskieren Sie nicht, dass Ihnen das Wort entzogen wird, bevor Sie das Wichtigste gesagt haben. Tipp: Machen Sie sich eine Notiz in den Unterlagen, an welchem Punkt drei Viertel der Zeit verstrichen sein sollten. Zeigt ein Blick auf die Uhr, dass Sie dem Zeitplan hinterher hängen, können Sie den Rest in abgespeckter, vielleicht sogar stichpunktartiger Form präsentieren.