Berufsbild Digital Humanities
Digitale Geisteswissenschaften: Aufgaben, Studium und Berufschancen
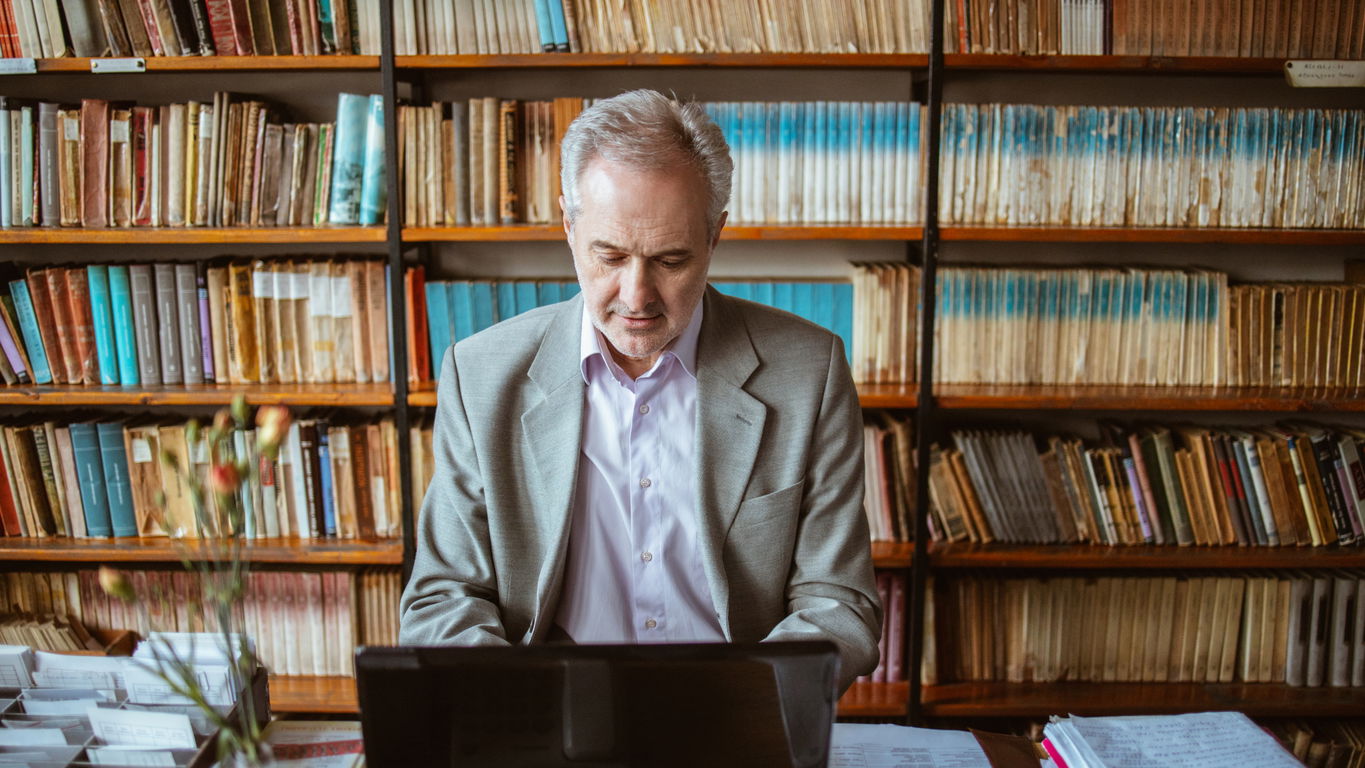
Digitale Methoden haben zuletzt mehr und mehr Einzug in den Alltag geisteswissenschaftlicher Fächer gefunden. © Ika84 / iStock
Aus der zunehmenden Verfügbarkeit digitaler Daten ergeben sich für die Geisteswissenschaften viele neue Forschungsmöglichkeiten. Ob Digitalisierung, Datenaufbereitung oder deren Analyse – die Aufgabengebiete in den Digital Humanities sind vielfältig. Ein Master-Aufbaustudium verbessert die Job- und Gehaltsaussichten von Geisteswissenschaftler:innen enorm.
Aktualisiert: 14.10.2024
Digital Humanities: Das Wichtigste in Kürze
- Digital Humanities ist ein interdisziplinäres Fach, bei dem geistes- oder kulturwissenschaftliche Daten oder Dokumente systematisch mithilfe computer- oder KI-basierter Technologien erschlossen, digitalisiert und kuratiert werden
- Aufgaben von Digital Humanists: Aufbau von Datensammlungen, Datenmodellierungen, Textkodierungen und XML-Technologien, Erstellung digitaler Editionen von Texten, digitaler Bibliotheken und Informationssysteme und quantitative Analysen
- Ein Großteil der Digital Humanists arbeitet in der Forschung. Das Gehalt bemisst sich somit in der Regel nach TV-L E13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen) oder der W-Besoldung (Professor:innen)
Artikelinhalt
Definition: Was ist Digital Humanities?
Digital Humanities, auch Digitale Geisteswissenschaften oder e-Humanities genannt, sind ein Forschungsbereich an der Schnittstelle zwischen Informatik und Geisteswissenschaften und verbinden daher Arbeitsweisen und Methoden beider Seiten; sie zählen zu den Dokumentationswissenschaften.
Geisteswissenschaftliche Daten werden zum einen mithilfe statistischer Methoden erschlossen, digitalisiert und kuratiert, zum anderen wird auch die Informatik mit einem geisteswissenschaftlichen Blick bedacht. Zu den geisteswissenschaftlichen Disziplinen zählen die klassischen Fächer der Sprach- und Literaturwissenschaften, beispielsweise Germanistik, Anglistik und Romanistik, die Pädagogik, die Geschichtswissenschaften, die Ethnologie sowie die Medien-, Kunst-, Theater- und Musikwissenschaften.
Damit sind die Digital Humanities ein sehr breites und vielfältiges Forschungsgebiet, das die Zeugnisse der kulturellen Evolution in digitaler Form zugänglich macht. Durch die Vernetzung der beiden Forschungsbereiche entstehen nicht nur neue Möglichkeiten, Daten zu verknüpfen, sondern auch innovative Formen der sozialen Wissensarbeit. Etwa seit 2005 gewinnen die Digitalen Geisteswissenschaften unter anderem durch die gestiegene Verfügbarkeit relevanter digitaler Daten stark an Bedeutung. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) hat zudem völlig neue Möglichkeiten eröffnet.
Digital Humanities: Berufe und Aufgaben
Laut Christof Schöch, Professor für Digital Humanities an der Universität in Trier und 1. Vorsitzender des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. (DHd), arbeitet rund die Hälfte der studierten Digitalen Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen in der Forschung. Computerbasierte Verfahren greifen in diverse Bereiche der Geisteswissenschaften ein und spielen eine tragende Rolle in der universitären Bildung. Die andere Hälfte arbeitet an staatlichen Organisationen oder in der freien Wirtschaft.
Digital Humanists sind insbesondere dort gefragt, wo sich geisteswissenschaftliche Arbeitsfelder durch die Digitalisierung und Vernetzung deutlich verändert haben. Sie beschäftigen sich beispielsweise mit dem Aufbau von Datensammlungen, mit Datenmodellierungen, Textkodierungen und XML-Technologien, sie erstellen digitale Editionen von Texten, digitale Bibliotheken und Informationssysteme und führen quantitative Analysen durch.
Jobs gibt es beispielsweise
- für wissenschaftliche Mitarbeitende oder auch Projektleitende an universitären oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen
- in den Sektoren des Bildungswesens wie Schulen oder der Erwachsenenbildung
- als Fachreferenten und Fachreferentinnen in Bibliotheken oder in deren Forschungsabteilungen
- in Bundes- oder Landesarchiven oder Museen, die derzeit stark digitalisiert werden
- in Verlagen und Online-Medien
- in Unternehmen, die digitale Angebote und Services in Bezug auf digitale Publikationsformate entwickeln
- in Firmen und Organisationen, die sich mit dem Aufbau und der Gestaltung der Informationsversorgung und des Informationsmanagements beschäftigen.
Durch die beschleunigte Veränderung der digitalen Welt entstehen zudem auch immer wieder neue, heute noch nicht absehbare Jobperspektiven.
Das Studium der Digital Humanities
Digital Humanities lässt sich als eigenständiges Fach an immer mehr Universitäten studieren – Tendenz rasant steigend. Laut HeyStudium gibt es mittlerweile 33 Studiengänge für Digital Humanities in Deutschland. Weltweit listet das Digital Humanities Course Registry zahlreiche Studiengänge und Spezialisierungskurse auf. Der Bachelor reicht als berufsqualifizierender Abschluss aus, in der Regel absolvieren Studenten und Studentinnen laut Professor Schöch aber noch den Master.
Auch die Promotion ist an einigen Universitäten im Fach Digital Humanities möglich, oft finanziert durch eine Stelle in einem Forschungsprojekt. Vorteil der Promotion ist neben der besseren finanziellen Verhandlungsbasis vor allem die größere Chance auf eine unbefristete Anstellung im wissenschaftlichen Bereich.
Studieninhalte der Digitalen Geisteswissenschaften
Generell sind die Studieninhalte je nach Standort recht heterogen; an der Uni Trier ist der Bachelor vergleichsweise breit aufgestellt und umfasst die Fachbereiche Digital Humanities, Computerlinguistik, Medienwissenschaften und Phonetik. Im Masterstudiengang können sich die Studentinnen dann auf einen dieser Bereiche fokussieren. An der Universität Bamberg beispielsweise ist der Studiengang eher medieninformatisch ausgerichtet, andere Standorte legen Schwerpunkte auch auf Geschichte, Literaturwissenschaft oder Archäologie. Auch ein Fernstudium der Digital Humanities ist möglich, beispielsweise bietet die FernUni Hagen diesen Studiengang an.
Standortübergreifend sind jedoch die methodischen Schlüsselkompetenzen, die im Studium vermittelt werden: Die Möglichkeiten der Digitalisierung im Allgemeinen und die Veränderungen, die die digitale Transformation mit sich bringt. Zu den Lehrinhalten zählen beispielsweise der Umgang mit Datenbanken, das Programmieren sowie Kenntnisse über das maschinelle Lernen und künstliche Intelligenz, über statistische Verfahren oder auch im Natural language processing (NLP), also Kenntnisse zur Anwendung von Techniken und Methoden zur maschinellen Verarbeitung natürlicher Sprache. Das Studium ist in der Regel stark praxisorientiert und wird anhand von Beispielprojekten, Forschungsfragen oder Anwendungsperspektiven aufgebaut.
Darüber hinaus gibt es weiterhin die Möglichkeit, seinen Bachelor in einem rein geisteswissenschaftlichen Fach oder in Informatik zu machen, und sich dann im Master in der anderen Richtung zu spezialisieren. In der Praxis sind es zum Großteil Geisteswissenschaftler mit Bachelorabschluss, die aus Interesse oder aus berufsstrategischen Gründen den Entschluss fassen, sich im Masterstudiengang Digital Humanities die technische Komponente anzueignen.
Berufsaussichten in den Digital Humanities
Verglichen mit anderen geisteswissenschaftlichen Fächern sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehr gut – soweit sich das bei einem so jungen Studiengang überhaupt sagen lässt. Doch nach der Einschätzung von Professor Schöch seien Digitale Geisteswissenschaftler gefragte Absolvent:innen. Oft würden sie schon vor dem Masterabschluss angeworben.
In Stellenanzeigen aus der Wirtschaft wird allerdings noch recht selten explizit ein Abschluss in Digital Humanities gefordert – bei den Stellen in Wissenschaft und Forschung hingegen schon. Dennoch passen die Anforderungen vieler Unternehmen gut zu den erworbenen Fähigkeiten der Digitalen Geisteswissenschaftlerinnen.
Gehalt im Bereich Digitale Geisteswissenschaften
Erhebungen zu den Gehaltsstrukturen in den Digital Humanities haben noch nicht stattgefunden (hier ein Überblick über Gehälter von Geisteswissenschaftlern im Allgemeinen). In Wissenschaft und Forschung sowie in Archiven und bei anderen Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes werden die Angestellten in der Regel nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) bezahlt und dort in die Entgeltgruppe E13 eingeordnet.
Je nach Berufserfahrung verdienen Digitale Geisteswissenschaftler im Jahr 2024 somit grob zwischen 4.200 und 6.000 Euro brutto im Monat (in Vollzeit). In Führungspositionen ist laut Schöch auch eine Einordnung in E14 möglich; diese Digital Humanists verdienen 2024 monatlich etwa 4.500 bis 6.500 Euro brutto. Professor:innen werden nach der W-Besoldung vergütet und können bis zu 8.000 Euro brutto Grundgehalt pro Monat verbuchen. In der freien Wirtschaft sind die Gehälter Verhandlungssache, orientieren sich aber vielfach an den Tarifverträgen.








