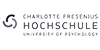Wissenschaftliche Mitarbeit
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen – Aufgaben, Voraussetzungen, Rechtliches

© Paul Bradbury / iStock.com
- Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen Professor:innen und Dozent:innen in Lehre, Forschung und Verwaltung.
- Voraussetzung für eine WiMi-Anstellung ist ein abgeschlossenes Studium sowie Erfahrungen in Forschung & Lehre.
- Das Gehalt ist tariflich geregelt und bemisst sich in der Regel nach Entgeltgruppe E13.
Aktualisiert: 29.10.2025
Wissenschaftliche Mitarbeit: Was ist das?
Nach dem Studium noch an der Universität bleiben? Das ist für diejenigen interessant, die Lust haben, ihr Fachgebiet zu vertiefen und weiter in die Welt der Wissenschaft einzutauchen. Als wissenschaftlichr Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin – kurz „WiMi“ – beschäftigen sie sich täglich mit Forschungen, Untersuchungen und der Wissensvermittlung.
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen unterstützen Professor:innen, Dozent:innen oder Projektleiter:innen an dem jeweiligen Institut. Das macht auch der englische Fachbegriff „Research Assistant“ deutlich. Während ihrer Tätigkeit an der Hochschule arbeiten wissenschaftliche Mitarbeiter:innen entweder an ihrer Dissertation, bereiten sich auf die Promotion vor oder haben diese bereits erfolgreich abgeschlossen (Postdoc).
Voraussetzungen für eine WiMi-Stelle
Um sich auf eine Stelle als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in bewerben zu können, ist ein abgeschlossenes Studium notwendig. Erfahrungen mit wissenschaftlichem Arbeiten und Forschen sind erforderlich, um die Arbeiten eines oder einer wissenschaftlich Mitarbeitenden angemessen erfüllen zu können. Bei einem Vorstellungsgespräch als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in geht es allerdings insgesamt weniger um praktische Berufserfahrungen als um die bisherige akademische Ausbildung.
Haushaltsstelle, Drittmittelstelle, Projektstelle
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen können auf einer Haushaltsstelle tätig sein. Haushaltsstellen sind die Mitarbeiterstellen, die zum Etat eines Professors oder einer Professorin gehören und die diesem von der Universität im Rahmen von Berufungs- oder Bleibeverhandlungen eingeräumt wurden. Diese Stellen werden über die Universitätsverwaltung öffentlich ausgeschrieben und sind in der Regel über Fachgesellschaften oder im Stellenmarkt von academics zu finden.
Alternativ ist es möglich, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen von Drittmittel- und Projektstellen tätig zu sein. Projektstellen sind explizit an ein Projekt gebunden, Drittmittelstellen werden extern finanziert, beispielsweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder vom Bund.
Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede der verschiedenen Anstellungsmöglichkeiten auf. Bitte beachten: Dies ist eine allgemeine Übersicht; die Ausgestaltung kann sich an den einzelnen Einrichtungen davon unterscheiden.
| Haushaltsstelle | Drittmittelstelle | Projektstelle | |
|---|---|---|---|
|
Definition |
Stelle aus dem regulären Haushalt der Einrichtung (z. B. Universität). |
Stelle, die aus externen Fördermitteln (z. B. DFG, EU, Industrie) finanziert wird. |
Stelle, die projektbezogen eingerichtet wird – Finanzierung kann intern oder extern erfolgen. |
|
Finanzierungsquelle |
Öffentliche Mittel (Land, Bund, Einrichtung selbst) |
Drittmittelgeber (extern) |
Drittmittel oder Haushaltsmittel |
|
Dauer / Befristung |
Häufig unbefristet oder längerfristig |
Meist befristet, abhängig von Projektlaufzeit |
Immer befristet, abhängig vom Projekt |
|
Stellenverfügbarkeit |
Teil des festen Stellenplans der Einrichtung |
Projektabhängig, oft kurzfristig verfügbar |
Projektabhängig, temporär verfügbar |
|
Sicherheit |
Hohe Arbeitsplatzsicherheit |
Geringere Sicherheit, da abhängig von Projektfinanzierung |
Geringe Sicherheit, da projektgebunden |
|
Karriereperspektiven |
Gute Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Einrichtung |
Begrenzte Perspektiven, aber gute Netzwerkmöglichkeiten |
Projektbezogene Erfahrung, oft begrenzte Weiterentwicklung |
|
Flexibilität |
Weniger flexibel, da an institutionelle Vorgaben gebunden |
Höhere Flexibilität in Projektgestaltung und Forschungsthemen |
Abhängig vom Projekt – teils hohe thematische Flexibilität |
|
Verwaltungsaufwand |
Geringerer Aufwand, da standardisiert |
Höherer Aufwand durch Projektanträge, Berichte, Abrechnungen |
Ähnlich wie bei Drittmittelstellen, oft hoher administrativer Aufwand |
|
Vorteile |
Stabilität,langfristige Planung möglich; Teil der institutionellen Struktur |
Innovative Forschung; internationale Kooperationen; eigenständige Projektarbeit |
Praxisnahe Forschung; Teamarbeit; thematische Fokussierung |
|
Nachteile |
Weniger Innovationsspielraum; eingeschränkte Themenwahl |
Unsicherheit; hoher administrativer Aufwand; Befristung |
Befristung; geringe Planungssicherheit; Abhängigkeit vom Projektverlauf |
Quelle: academics © academics
Aufgaben von wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen
Die vielfältigen Aufgabenbereiche von wissenschaftlich Mitarbeitenden haben sowohl theoretische als auch praktische Schwerpunkte. Dazu gehören beispielsweise
- administrative Aufgaben wie zum Beispiel das Verwalten von Dokumenten
- das Abhalten von Vorlesungen und Seminaren
- die Unterstützung des Professor oder der Professorin bei Vorlesungen
- die Auswertung wissenschaftlicher Studien
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen unterstützen zudem Studierende bei Fragen rund um den Fachbereich, etwa zu Hausarbeiten sowie Bachelor- und Masterarbeiten. Viele verfassen außerdem eigene Artikel für wissenschaftliche Fachbeiträge oder veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse in Buchform.
Nach der Promotion und der Habilitation ist es für wissenschaftliche Mitarbeiter:innen grundsätzlich möglich, zu Privatdozent:innen aufzusteigen. Hieraus kann sich eine Professur ergeben, die nicht zwangsläufig im eigenen Institut angesiedelt sein muss.
Diese WiMi-Stellenangebote könnten Sie interessieren
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Jura • Wissenschaftlicher Mitarbeiter Informatik • Wissenschaftlicher Mitarbeiter Chemie • Wissenschaftlicher Mitarbeiter Biologie • Wissenschaftlicher Mitarbeiter Physik • Wissenschaftlicher Wissenschaftlicher Mitarbeiter Erziehung, Pädagogik, Weiterbildung • Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gesundheit, Pflege, Sport • Wissenschaftlicher Mitarbeiter Psychologie, Psychotherapie
Der rechtliche Rahmen: Arbeitsvertrag, Arbeitszeiten, Kündigungsfrist
Viele Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter:innen sind auf Teilzeit ausgeschrieben. Oft sind es 20 Wochenstunden, die für den Job anfallen – ideal, um nebenbei noch Zeit für die Dissertation zu haben. Allerdings arbeiten die meisten WiMis deutlich länger als vereinbart, da sie sich so bessere Karrierechancen erhoffen. Die Arbeit für die Dissertation bleibt deshalb häufig auf der Strecke.
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen handeln grundsätzlich weisungsgebunden. Die Einrichtungsleitung oder die Fachvorgesetzen sind ihnen gegenüber weisungsbefugt. Nur in begründeten Fällen können wissenschaftlichen Mitarbeitenden die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben übertragen werden.
Die Kündigungsfrist von wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen richtet sich nach § 34 TV-L. Sie ist abhängig von der Beschäftigungszeit. Je länger ein WiMi an der Einrichtung tätig ist, desto länger sind die einzuhaltenden Fristen:
- Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beispielsweise beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsende.
- Wer bereits länger als ein Jahr angestellt ist, hat eine sechswöchige Kündigungsfrist zum Ende eines Quartals.
- Für WiMi, die mindestens fünf Jahre für die Einrichtung arbeiten, gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist zum Schluss eines Kalendervierteljahres.
Wie lange darf man Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in sein?
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen arbeiten meistens in einem befristeten Angestelltenverhältnis. Dabei gelten rechtliche Besonderheiten. In der Wissenschaft werden Befristungen von Anstellungsverhältnissen anders gehandhabt als im allgemeinen Arbeitsrecht. Grundlage ist das 2007 eingeführte Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft, kurz Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG).
Die dort aufgeführten, speziellen Befristungen tragen dem Umstand Rechnung, dass durch personelle Rotationen regelmäßig neue, nachrückende Studierende wissenschaftlich tätig werden können. So hat der akademische Nachwuchs immer wieder Chancen, sich in Forschung und Lehre für die Berufswelt zu qualifizieren.
Eine zentrale Vorgabe ist die sogenannte 12-Jahres-Regelung. Sie besagt, dass eine befristete Beschäftigung von Wissenschaftler:innen an Hochschuleinrichtungen maximal für insgesamt zwölf Jahre zulässig ist. Das gilt auch bei Unterbrechungen und im Falle verschiedener Arbeitgeber. Ausnahme sind Mediziner:innen. Für sie gilt eine Frist von 15 Jahren.
Wichtig: Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen können maximal sechs Jahre vor der Promotion angestellt werden. Wird die Promotion früher als nach sechs Jahren erfolgreich abgeschlossen, ist es möglich, diese nicht genutzten Jahre vor der Promotion zu den sechs Jahren nach der Promotion hinzuzurechnen. Allerdings zählen auch Zeiten von Promotionsstipendien und andere Promotionszeiten ohne Anstellung mit.
Eine Besonderheit gilt bei drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten. Die Dauer der Befristung richtet sich hier nach der Projektlaufzeit. Das heißt: Auch nach Ablauf der zwölf Jahre können solche Stellen mit befristeten Arbeitsverträgen weiterhin angenommen werden. Befristete Drittmittelstellen sind demnach auch über die Höchstbefristungsdauer hinaus möglich, wenn
- eine Stelle überwiegend aus Drittmitteln finanziert wird,
- diese Finanzierung für eine bestimmte Aufgabe und einen festen Zeitraum bewilligt wurde und
- der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin überwiegend dieser Zweckbestimmung entsprechend eingesetzt wird.
Das Gehalt von wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen
Das Gehalt von wissenschaftlichen Mitarbeitenden ist tariflich festgelegt. Nach welchem Tarif eine Einrichtung zahlt, findet sich in der Stellenausschreibung wieder. Dabei gilt für Bundeseinrichtungen der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund). Daneben gibt es den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), auf den sich die Bundesländer beziehen, und der für die wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen an den meisten Hochschulen gilt. Eine Ausnahme bildet Hessen. Das Bundesland hat mit den Gewerkschaften einen eigenen Tarifvertrag abgeschlossen, den TV-H.
Die Vergütungshöhe bemisst sich anhand zweier Faktoren: der Entgeltgruppe und der in dieser Gruppe erreichten Erfahrungsstufe. WiMi sind meist in der Entgeltgruppe E13 eingruppiert, aber auch eine Einstufung in die Entgeltgruppe E14 ist je nach Anforderungsprofil möglich. Welche Erfahrungsstufe innerhalb der Entgeltgruppe erreicht wird, ist von der einschlägigen Berufserfahrung abhängig. Dafür sehen die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst sechs Erfahrungsstufen mit jeweils wachsenden Stufenlaufzeiten vor.