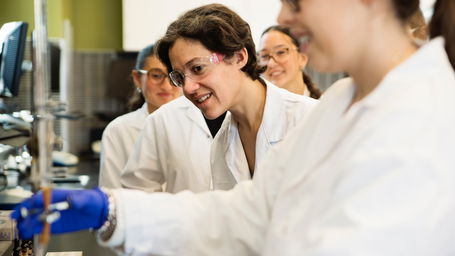Interview: Dr. Sarah Rachut
„Ich baue sehr gerne Brücken“

Dr. jur. Sarah Rachut © privat
Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben und damit auch die Regeln unseres Zusammenlebens? Wer darf welche Daten erheben und verarbeiten? Die Juristin Dr. Sarah Rachut, Postdoc an der TU München, sucht und findet Antworten auf diese und mehr Fragen an der Schnittstelle zwischen Recht und Technik.
Aktualisiert: 02.07.2025
Zur Person: Dr. jur. Sarah Rachut, Ass. jur.
Dr. Sarah Rachut ist Volljuristin und arbeitet aktuell als Postdoc am Lehrstuhl für Recht und Sicherheit der Digitalisierung an der Technischen Universität München. Außerdem ist sie dort Geschäftsführerin der Forschungsstelle TUM Center for Digital Public Services (CDPS).
Rachut ist seit 2020 Teilnehmerin im Talentprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales „BayFiD – Bayerns Frauen in Digitalberufen“ und wird seit 2022 vom Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation gefördert. 2024 wurde sie vom Handelsblatt und POSSIBLE mit dem Young Leader in Gov Tech Award ausgezeichnet. Außerdem ist Sarah Rachut Sprecherin des Arbeitskreises „E-Government-Recht“ des NEGZ · Kompetenznetzwerk Digitale Verwaltung.
academics: Frau Dr. Rachut, worauf liegt Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt?
Dr. Sarah Rachut: Ich befasse mich mit Themen im Schnittfeld von Recht und Technik und hierbei insbesondere mit verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Fragestellungen. Aktuell beschäftigt mich zum Beispiel, wie künstliche Intelligenz unser Leben und damit auch die Regeln unseres Zusammenlebens verändert. Darf der Staat, also die Verwaltung und die Justiz, etwa KI zur Unterstützung einsetzen? Und wenn ja, wozu, wie und in welchem Umfang?
Außerdem bewegen ich mich die großen Rechtsfragen der digitalen Transformation: Allgemein finden durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche viel mehr Datenverarbeitungsvorgänge statt. Hier gilt es zu klären, wer welche Daten erheben und verarbeiten darf. Denn Daten und die darin enthaltenen Informationen bedeuten auch Macht. Ging es früher vor allem darum zu verhindern, dass staatliche Stellen zu viele – gerade personenbezogene – Daten verarbeiteten, stehen heute private Akteure und Unternehmen im Fokus. Etwa wenn es darum geht, dass soziale Medien die Verbreitung von Meinungen über ihre Algorithmen steuern können.
Was zeichnet Sie als Wissenschaftlerin aus?
Ich baue sehr gerne Brücken – zu anderen Fachrichtungen, aber auch innerhalb der Rechtswissenschaft. Denn einerseits lassen sich die Rechtsfragen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation nicht isoliert betrachten. Hier ist man auf die Erkenntnisse aus anderen Disziplinen der Natur- oder Sozialwissenschaften angewiesen. Und andererseits sind viele Herausforderungen, z.B. der Umgang mit großer Komplexität nicht digital- oder technikspezifisch. Das heißt, hier können auch Gedanken und Lösungsansätze aus anderen Konstellationen oder Rechtsgebieten wertvollen Input geben.
Beschreiben Sie sich mit drei Adjektiven.
Wissbegierig, kreativ, mutig.
Wenn Sie sich ein Zukunftsszenario für digitale Verwaltungsdienste in Deutschland wünschen dürften – wie sähe das aus?
Wenn es nach mir ginge, dürfen wir hier ruhig groß denken. Das heißt: Wir sollten nicht versuchen, unsere bestehenden Prozesse einfach digital abzubilden, sondern den Transformationsprozess nutzen, um auch das Selbstverständnis der Verwaltung zu überdenken.
Ich würde mir etwa wünschen, dass wir von der antragsbasierten Verwaltung wegkommen. Damit meine ich, dass der Staat beziehungsweise die öffentliche Verwaltung Leistungen, auf die Bürger:innen einen Anspruch haben, automatisiert veranlasst und hierfür nicht zuerst Anträge gestellt und Informationen und Nachweise – die der Staat in der Regel bereits hat – aufwendig beigebracht werden müssen. Das macht den Prozess nicht nur schlanker, sondern verhindert auch unnötige Übertragungsfehler.
Je mehr es uns außerdem gelingt, die Potenziale digitaler Technologien sinnvoll zu integrieren, desto mehr entlasten wir die Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten. So können sich diese dann auf die Aspekte konzentrieren, die nach einer menschlichen und vor allem empathischen Entscheidung verlangen. In meinen Zukunftsszenario wäre die öffentliche Verwaltung somit nicht nur effizienter aufgestellt, sondern auch mehr für die Bürger:innen da.
Was ist das größte Missverständnis über die Digitalisierung im öffentlichen Sektor?
Der größte Irrglaube oder das größte Missverständnis bezieht sich wohl darauf, dass das Recht die Digitalisierung verhindern würde. Oftmals werden hier zum Beispiel datenschutzrechtliche Bedenken vorgebracht. Dabei werden aber entscheidende Punkte vergessen. Denn das Datenschutzrecht schützt nicht Daten, sondern die Persönlichkeitsrechte der dazugehörigen Personen – also Menschen. Das bedeutet, dass viele wertvolle Daten, die keinen Personenbezug enthalten, zum Beispiel Objekt- oder Maschinendaten, gar nicht dem Datenschutzrecht unterfallen.
Außerdem – auch wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden – gilt das Datenschutzrecht bzw. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht absolut. Das heißt, die Interessen zum Schutz der Persönlichkeit müssen vielmehr mit den Interessen zur Datennutzung abgewogen werden. Auch an anderen Stellen haben wir bereits viele Möglichkeitsräume, die schlicht nicht genutzt werden.
Dr. jur. Sarah Rachut
Sie haben sich in einem noch immer männerdominierten Bereich – der Rechtswissenschaft und insbesondere dem Informationsrecht – etabliert. Gab es auf Ihrem Weg Hürden, die Sie als Frau besonders meistern mussten?
Das juristische Umfeld ist eher konservativ und hält an althergebrachten Strukturen und Rollenbildern fest. Das erkennt man zum Beispiel an Stereotypen in juristischen Aufgabenstellungen oder daran, dass Lehrbücher auch heute noch Frauen Rock und Perlenohrringe für die mündliche Prüfung empfehlen.
Tatsächlich studieren inzwischen sogar mehr Frauen als Männer in Deutschland Rechtswissenschaft. Allerdings ist die Verteilung auf die verschiedenen Berufszweige und Rechtsgebiete sehr unterschiedlich und gerade das Feld, in dem ich mich bewege, also das Internetrecht oder Recht der Digitalisierung, ist männerdominiert. Trotz dessen habe ich mich hier immer sehr wohl und auch wertgeschätzt gefühlt. Das liegt aber eher daran, dass es sich noch um ein relativ junges und damit modernes Rechtsgebiet handelt.
Hürden bestehen aber trotzdem. Soweit es mich betrifft, haben sich diese mit der Zeit reduziert. Hier haben der akademische Titel und die Sichtbarkeit in meinem Forschungsfeld definitiv geholfen. Entscheidend war zudem, dass ich Allies um mich herum hatte.
Diese Jobs könnten Sie interessieren
Sie sind nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch in der Leitung des TUM Center for Digital Public Services aktiv. Wie erleben Sie diese Doppelrolle als Forscherin und Führungskraft?
Tatsächlich ergänzen sich beide Rollen sehr gut. Denn auch in der Wissenschaft – etwa als Professor oder Professorin – ist man letztlich Führungskraft und benötigt neben den Fachkompetenzen ebenso soziale Kompetenzen.
Hinzu kommt: Jurist:innen werden oftmals Führungs- und Ausbildungsaufgaben übertragen, sei in einer Kanzlei, der Verwaltung oder der Justiz. Dennoch spielt dieser Part des juristischen Berufs in der Ausbildung keine Rolle. Dessen war ich mir relativ früh bewusst und habe mich daher schon vor meiner Zeit am CDPS aktiv mit dem Thema Führung befasst. Die weiteren Aufgaben am CDPS zu übernehmen, hat mir daher viel Freude bereitet.
Jetzt entdecken: Zia – Visible Women in Science and Humanities
Das ZEIT Fellowshipprogramm „Zia – Visible Women in Science and Humanities“ inspiriert, vernetzt und fördert Wissenschaftlerinnen. Werden auch Sie Teil des Netzwerk – als Fellow, Partner, Förderer oder Role Model. Erfahren Sie mehr auf der Zia Homepage und entdecken Sie unseren Newsletter rund um Frauen in der Wissenschaft!
Welche Rolle haben Mentor:innen oder Netzwerke in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn gespielt? Gab es jemanden, der Sie besonders gefördert hat?
Ohne Mentor:innen und den vertrauensvollen Austausch mit Gleichgesinnten wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Von Anfang an und in besonderer Weise hat mich dabei Prof. Dr. Dirk Heckmann gefördert. Er hat nicht nur mein Interesse an der Wissenschaft geweckt, sondern mich auch ermutigt, meinen eigenen Weg zu gehen. Dabei stand er mir immer als Sparringpartner und mit ehrlichem und konstruktivem Feedback zur Seite. Er hat mir zahlreiche Türen geöffnet und meine Leistung stets anerkannt und auch nach außen kommuniziert. Das war gerade am Anfang meiner wissenschaftlichen Laufbahn sehr wichtig.
Darüber hinaus gibt es in der Wissenschaft immer wieder Phasen, die besonders herausfordernd sind. Gerade dann ist ein gutes Netzwerk sehr viel wert.