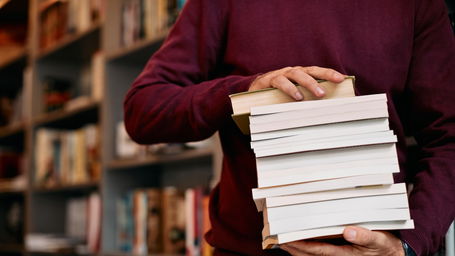Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien
Sichtbar in der Wissenschaft: Erfolgreiche „Wisskomm“ auf Social Media

© Victollio / iStock.com
Die Wissenschaftskommunikation hat sich durch soziale Medien in den letzten Jahren stark gewandelt. Forschende haben heute die Möglichkeit, ihre Arbeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und sich mit Kolleg:innen zu vernetzen. Doch wie gelingt eine erfolgreiche Selbstvermarktung als Wissenschaftler:in in sozialen Medien? Welche Plattformen eignen sich besonders gut, und welche Fallstricke sollten vermieden werden? Dr. Ulrike Brandt-Bohne, Dozentin am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik), gibt Antworten.
Aktualisiert: 14.03.2025

Dr. Ulrike Brandt-Bohne ist Dozentin und leitet den Bereich E-Learning am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) in Karlsruhe. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Wissenschaftskommunikation, Dialogformaten und dem öffentlichen Diskurs über Forschung. In ihrer Lehrtätigkeit berät sie Forschende, wie sie ihre Themen verständlich, zielgruppengerecht und wirkungsvoll vermitteln können.
Warum sollten Wissenschaftler:innen Social Media nutzen?
Soziale Medien bieten Wissenschaftler:innen zahlreiche Vorteile, die weit über das bloße Teilen von Forschungsergebnissen hinausgehen. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, die eigene Forschung sichtbarer zu machen. Brandt-Bohne erklärt: „Mehr Aufmerksamkeit für die eigene Forschung kann dazu führen, dass sie häufiger zitiert wird oder dass Wissenschaftler:innen zu Vorträgen eingeladen werden.“
Darüber hinaus ermöglichen soziale Netzwerke Ihnen die direkte Vernetzung mit Fachkolleg:innen und Entscheidungsträger:innen. Besonders in Zeiten, in denen Desinformation kursiert, ist es essenziell, dass Wissenschaftler:innen selbst als vertrauenswürdige Quellen agieren. „Soziale Medien geben Forschenden die Möglichkeit, wissenschaftliche Fakten verständlich und zielgerichtet zu kommunizieren“, so Brandt-Bohne. Zudem schärft regelmäßige Wissenschaftskommunikation die Fähigkeit, komplexe Themen für ein breites Publikum aufzubereiten – eine Kompetenz, die auch in der Lehre und beim Verfassen wissenschaftlicher Publikationen von Vorteil ist.
X, Insta, LinkedIn: Die richtige Plattform finden
Nicht jede Plattform eignet sich für jede Art von Wissenschaftskommunikation. Je nach Zielgruppe und Inhalt bieten unterschiedliche soziale Netzwerke verschiedene Vorteile. Die folgende Übersicht hilft Ihnen dabei, die passende Plattform für Ihre Bedürfnisse zu finden:
Soziale Plattformen im Überblick
| Plattform | Zielgruppe | Inhalt | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|---|
|
Kurznachrichtendienste (X, Threads, Bluesky, Mastodon) |
Fachkolleg:innen, Journalist:innen, Wissenschaftsinteressierte |
Textbasierte Kurznachrichten (280–500 Zeichen), Diskussionen, Links zu Publikationen |
Schnelle Verbreitung aktueller Forschungsergebnisse, direkter Austausch mit Fachpublikum, hohe Sichtbarkeit für Debatten |
Hohe Dynamik erfordert regelmäßige Aktivität, oft hitzige Diskussionen, algorithmische Sichtbarkeit unsicher |
|
|
Fachkolleg:innen, Arbeitgeber:innen, Förderinstitutionen |
Längere Beiträge, Artikel, Updates von Unternehmen, Diskussionen |
Professionelle Vernetzung, Karriereförderung, wissenschaftliche Inhalte in seriösem Umfeld |
Weniger Reichweite für interaktive Wissenschaftskommunikation, weniger spontane Diskussionen |
|
|
Breite Öffentlichkeit, Studierende, Wissenschaftler:innen in frühen Karrierephasen |
Hochwertige Bilder, Infografiken, Karussell-Posts, Reels (Kurzvideos) |
Ästhetische Darstellung von Forschung, guter Zugang zur jungen Zielgruppe |
Erfordert visuell ansprechende Inhalte, wissenschaftliche Tiefe ist schwerer zu vermitteln |
|
TikTok |
Junge Zielgruppen, Wissenschaftsinteressierte |
Kurzvideos, oft Hochkant, trend-basierte Inhalte |
Hohe Reichweite durch virale Inhalte, gute Möglichkeit zur anschaulichen Wissenschaftskommunikation |
Erfolg ist weniger gut steuerbar und algorithmusabhängig, hohe Content-Konkurrenz, Zeitaufwand für Videoproduktion |
|
|
Breite Öffentlichkeit, Gruppen und Communitys |
Beiträge, Bilder, Gruppenposts, Live-Streams |
Gute Erreichbarkeit über Gruppen, hohe Relevanz im englischsprachigen Forschungsraum |
Abnehmende Nutzung bei jungen Forschenden, geringe organische Reichweite |
|
ResearchGate |
Fachkolleg:innen, Wissenschaftler:innen |
Fachartikel, Paper-Sharing, Q&A |
Gute Plattform zur Präsentation eigener Publikationen, Austausch mit der Fachcommunity |
Nicht geeignet für öffentliche Wissenschaftskommunikation, begrenzte Interaktion mit Nicht-Wissenschaftler:innen |
Quelle: academics ©academics
Dr. Brandt-Bohne rät, sich auf ein bis zwei Plattformen zu konzentrieren, anstatt auf vielen Kanälen sporadisch aktiv zu sein. „Es ist besser, eine Plattform richtig zu nutzen, als auf mehreren nur halbherzig präsent zu sein.“ Wer neu in der Wissenschaftskommunikation auf Social Media ist, sollte zunächst klein anfangen – idealerweise mit der Plattform, auf der sich die gewünschte Zielgruppe aufhält. Später lassen sich weitere Kanäle ergänzen, sobald Routinen etabliert sind.
Wechsel von X zu Bluesky oder Mastodon (?)
Seit dem Herbst 2024 – insbesondere im Zuge der US-Wahl und politischer Entwicklungen auf Twitter/X – erleben alternative Plattformen wie Bluesky und Mastodon einen deutlichen Zulauf. Viele Nutzer:innen kehren X den Rücken, nicht zuletzt wegen intransparenter Moderation, algorithmischer Unübersichtlichkeit und zunehmender politischer Radikalisierung im Diskurs. Auch Threads, das eng mit Instagram verknüpft ist, wird als mögliche Alternative genutzt – besonders von Personen, die bereits in der Meta-Welt aktiv sind.
Ob diese neuen Plattformen Twitter/X dauerhaft ablösen, bleibt offen. Dr. Brandt-Bohne beobachtet die Entwicklung mit Interesse: „Es ist noch schwer vorherzusagen, ob sich eher BlueSky oder Mastodon langfristig durchsetzen können, da die Reichweite aktuell geringer scheint. Für Wissenschaftler:innen bieten beide Plattformen Chancen, sobald technische Einstiegshürden und die Umstellung gelungen sind und somit genug Nutzende die jeweiligen Medien aktiv nutzen.“
Während Threads besonders für Instagram-affine Nutzer:innen interessant sein kann, ist Bluesky eine werbefreie Plattform mit einer dezentralen Struktur, die sich noch im Aufbau befindet. Mastodon wiederum bietet eine föderierte Alternative mit stärkerer Kontrolle über Inhalte, erfordert jedoch eine gewisse technische Einarbeitung.
Brandt-Bohne betont: „Entscheidend ist letztlich nicht nur, was gerade im Trend liegt, sondern welche Plattform zur eigenen Kommunikationsweise und Zielgruppe passt.“
Erfolgreiche Selbstvermarktung – Das Profil
Ein professionelles und konsistentes Online-Profil ist entscheidend für eine erfolgreiche Wissenschaftskommunikation. Achten Sie auf: ·
- Ein klares Profilbild und eine aussagekräftige Bio, die Ihre Forschung auf den Punkt bringt.
- Die gezielte Nutzung von Keywords und Hashtags, um in Suchanfragen besser gefunden zu werden.
- Eine konsistente Darstellung Ihrer Marke über verschiedene Plattformen hinweg.
Brandt-Bohne hebt hervor: „Ein überzeugendes Profil vermittelt nicht nur Fachkompetenz, sondern auch Persönlichkeit. Es zeigt, wofür Sie stehen und was Ihre wissenschaftliche Arbeit ausmacht.“ Eine klare, aber prägnante Selbstbeschreibung sowie Links zu relevanten Publikationen oder Projekten sind hier entscheidend.
Damit Ihr Profil in Suchanfragen oder themenspezifischen Feeds besser gefunden wird, sollten Sie gezielt relevante Keywords und Hashtags verwenden. Orientieren Sie sich dabei an Begriffen, die auch von Kolleg:innen Ihrer Fachrichtung genutzt werden – etwa auf LinkedIn, X oder Instagram. Häufig helfen auch branchenspezifische Hashtags wie #Wisskom, #ScienceCommunication, #Scicom oder #PhDLife, die Ihre Inhalte thematisch einordnen.
Wissenschaftliche Konferenzthemen, Paper-Titel oder aktuelle Forschungsdiskurse können ebenfalls Anhaltspunkte für geeignete Begriffe bieten. Darüber hinaus unterstützen Tools wie Hashtagify oder die automatische Hashtag-Vorschlagsfunktion der Plattformen bei der Auswahl.
Je zielgerichteter Ihre Begriffe gewählt sind, desto besser erreichen Sie Ihre Fachcommunity – und potenziell auch eine breitere Öffentlichkeit.
Der perfekte Inhalt
Ein erfolgreicher Social-Media-Auftritt basiert auf ansprechenden und relevanten Inhalten. Besonders wirkungsvoll sind:
- Storytelling
Machen Sie Ihre Forschung greifbarer, indem Sie sie in eine Geschichte einbetten. Brandt-Bohne betont: „Menschen erinnern sich an Geschichten besser als an bloße Fakten. Nutzen Sie Erzählstrukturen, um Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse spannend und verständlich zu vermitteln“
Ein Beispiel: Statt nüchtern zu schreiben, dass eine Studie gezeigt habe, wie Schlafmangel die Konzentration reduziert, lässt sich derselbe Befund in eine kleine Geschichte einbetten. Etwa so: Proband:innen mussten nach nur vier Stunden Schlaf einen Reaktionstest absolvieren – viele reagierten spürbar langsamer, was sich auch in den Daten widerspiegelte: Die Fehlerquote war doppelt so hoch wie nach einer erholsamen Nacht. Eine solche narrative Herangehensweise schafft Nähe und macht wissenschaftliche Inhalte gerade für ein breiteres Publikum leichter zugänglich. So wird aus einer abstrakten Aussage eine greifbare Erfahrung mit emotionalem Bezug.
- Visuelle Elemente
Infografiken, Bilder oder Videos erhöhen die Reichweite. „Gerade auf Instagram und LinkedIn funktionieren ansprechend gestaltete Bilder und Grafiken besonders gut. Nutzen Sie einfache, aber informative Visualisierungen.“
- Interaktion mit der Community
Gehen Sie auf Kommentare ein und regen Sie Diskussionen an. „Wissenschaft ist Dialog. Wer auf Fragen reagiert und sich aktiv in Diskussionen einbringt, wird langfristig als vertrauenswürdige Quelle wahrgenommen.“
Brandt-Bohne rät außerdem, Inhalte gezielt für die jeweilige Plattform anzupassen: „Während Kurznachrichtendienste eher für kurze, prägnante Statements oder Updates geeignet sind, können Sie auf LinkedIn oder Instagram neben Bildern auch längere Erklärtexte nutzen. TikTok hingegen lebt von schnellen, kreativen Erklärvideos.“
Herausforderungen und Risiken – wie mit Trollen und Hasskommentaren umgehen?
Auch die Sozialen Medien sind mit Herausforderungen und Risiken verbunden.
- Kritik und Trolle
Bleiben Sie professionell und sachlich im Umgang mit Kommentaren. Dr. Brandt-Bohne betont: „Unterschiedliche Meinungen sind Teil der Wissenschaft. Konstruktive Kritik kann bereichernd sein, aber wenn es beleidigend wird, sollten Sie klare Grenzen setzen.“
Wichtig ist, zwischen sachlicher Kritik und gezielter Provokation zu unterscheiden:
- Konstruktive Rückmeldungen bieten oft wertvolle Impulse – etwa zur Verständlichkeit eines Posts oder zur Interpretation von Daten. Hier lohnt sich der Dialog.
- Trolle, Hasskommentare oder persönliche Angriffe hingegen zielen nicht auf Austausch, sondern auf Verunsicherung ab.
In solchen Fällen stehen Ihnen auf den meisten Plattformen verschiedene Mittel zur Verfügung:
- Kommentare moderieren oder deaktivieren
- Nutzer:innen blockieren oder stummschalten
- Beiträge melden – oder bei strafrechtlich relevanten Inhalten: Anzeige erstatten
- Keine inhaltliche Diskussion mit Trollen beginnen – das entzieht ihnen die Bühne
Wenn Sie sich unsicher fühlen, bietet das NaWik spezielle Schulungen zum souveränen Umgang mit Kritik und Online-Konflikten. Ebenso hat das NaWik einen Leitfaden für den Umgang mit Angriffen im Netz konzipiert. Ergänzend hilft die Plattform scicomm-support.de mit konkreten Handlungsstrategien, rechtlicher Orientierung und psychosozialer Unterstützung für betroffene Forschende.
- Wissenschaftliche Integrität
Stellen Sie sicher, dass Ihre Forschung korrekt dargestellt wird. „Übertreibungen oder Halbwahrheiten können langfristig Ihre Glaubwürdigkeit untergraben. Bleiben Sie bei den Fakten, auch wenn das manchmal weniger Aufmerksamkeit bringt.“
- Urheberrecht und Datenschutz
Teilen Sie keine fremden Inhalte ohne Überprüfung – und achten Sie darauf, ob die Quelle vertrauenswürdig ist. Auch fremde Bilder oder Texte dürfen nicht ohne Erlaubnis übernommen werden. Brandt-Bohne erinnert: „Achten Sie darauf, dass Sie Bilder, Texte oder Studien nicht einfach übernehmen, sondern stets Quellen angeben.“ Ebenso gilt: Sensible Informationen über Dritte – z. B. Forschungsteilnehmer:innen – gehören nicht in öffentliche Posts.
Wissenschaftskommunikation effizient in den Alltag integrieren
Social Media muss nicht zeitaufwendig sein. Brandt-Bohne gibt Tipps für ein effizientes Zeitmanagement:
- Feste Zeitfenster einplanen (z. B. einmal pro Woche ein Update posten). „Ein wöchentlicher Post oder eine kurze Diskussion kann bereits ausreichen, um Ihre Präsenz zu stärken.“
- Teamarbeit: Social-Media-Kanäle können gemeinschaftlich geführt werden. „In vielen Forschungsgruppen arbeiten mehrere Personen an der Kommunikation. Nutzen Sie die Expertise im Team, um sich die Arbeit zu teilen.“
- Tools nutzen: Planungstools wie Buffer oder Hootsuite helfen bei der Organisation. „Automatisierte Planung kann den Aufwand erheblich reduzieren. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die es gibt, um effizient zu bleiben“.
Wissenschaft auf Social Media: 3 Tipps von @DieWissenschaftlerin
Amelie Reigl, Doktorandin der Biologie im Bereich Tissue Engineering und regenerative Medizin an der Universität Würzburg, ist als @DieWissenschaftlerin eine der bekanntesten Wissenschaftsinfluencerinnen im deutschsprachigen Raum.
Auf Instagram und TikTok begeistert sie mit verständlichen Inhalten, Alltagseinblicken und wissenschaftlicher Aufklärung ein stetig wachsendes Publikum.
Hier verrät Amelie Reigl drei zentrale Tipps für einen erfolgreichen Start auf Social Media:
- Strategie entwickeln: Überlegen Sie sich, was Sie kommunizieren möchten – und was Sie realistisch leisten können. Ein klarer Plan hilft, Inhalte gezielt und konsistent zu gestalten.
- Mit Spaß dabei sein: Begeisterung ist ansteckend! Authentische Kommunikation kommt besser an – und wirkt glaubwürdig.
- Neugierig bleiben & Zielgruppe im Blick behalten: Testen Sie Formate, reagieren Sie auf Feedback und denken Sie stets vom Publikum her. So bleibt der Kanal lebendig und relevant.
Lesetipp: Amelie Reigl im Interview