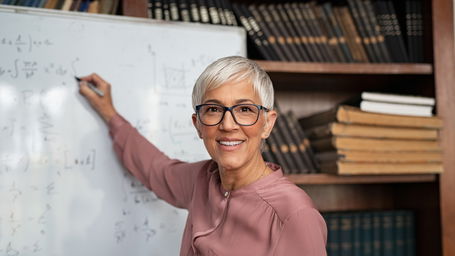Gehalt in der Forschung und Entwicklung
Was Forscher und Entwickler verdienen

© Azman Jaka / iStock
- Das Durchschnittsgehalt von Forschungs- und Entwicklungsingenieuren liegt branchenübergreifend bei ungefähr 62.000 Euro brutto im Jahr
- Laut einer Studie der Universität Kassel verdienen Absolvent:innen mit Doktortitel eineinhalb Jahre nach der Promotion im Mittel um 40 Prozent mehr als ihre Kolleg:innen mit Masterabschluss
- Forschung an Hochschulen: Das Gehalt von wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen liegt zwischen ca. 4.600 und 6.700 Euro brutto monatlich (Vollzeit), das von Professor:innen zwischen 5.000 und 9.200 Euro brutto
Aktualisiert: 30.04.2025
Forschung an Hochschulen: Gehalt vom wissenschaftlichen Mitarbeiter bis zur Professorin
An staatlichen Hochschulen in Deutschland richtet sich das Gehalt bei Forschung und Entwicklung für angestellte wissenschaftliche Mitarbeiter:innen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Einzige Ausnahme ist Hessen, das nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft ist. Hier gilt der TV-H bzw. für die TU Darmstadt der TV-TUD. An Bundeshochschulen richtet sich das Gehalt nach der Entgelttabelle des TVöD Bund.
Je nach Aufgabenfeld und Zuständigkeit werden die Wissenschaftler:innen den Entgeltgruppen E13, E14 und E15 zugeordnet. Doktorand:innen sowie Postdocs werden üblicherweise nach E13 bezahlt und verdienen monatlich zwischen rund 4.600 und 6.600Euro (Stufe 6) brutto. Forschungs- und Gruppenleiter:innen mit höherer Verantwortung werden in E14 oder (selten) E15 eingruppiert. Ihr Gehalt liegt grob zwischen 5.000 und 7.600 Euro brutto pro Monat.
Gehalt Doktorand:in und Postdoc (TV-L 2025*)
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 15 |
5.504,26 |
5.902,04 |
6.112,24 |
6.858,84 |
7.424,19 |
7.640,58 |
|
E 14 |
5.003,49 |
5.365,66 |
5.662,85 |
6.112,24 |
6.800,81 |
6.998,52 |
|
E 13 |
4.629,74 |
4.967,01 |
5.220,71 |
5.713,58 |
6.394,91 |
6.580,44 |
*) Gültig: 1.2.2025 bis 31.10.2025; alle Angaben brutto in Euro pro Monat
Quelle: oeffentlicher-dienst.infoProfessor:innen werden nach der W-Besoldung alimentiert. Die Höhe des Solds variiert dabei von Bundesland zu Bundesland, liegt aber bei einer W2-Professur in etwa zwischen 6.700 und 8.000 Euro brutto pro Monat.
Bei einer W3-Professur reicht die Spanne ca. von 7.300 bis 9.200 Euro brutto pro Monat (Grundgehalt ohne Zulagen). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel zum Professorengehalt.
F&E an außeruniversitären Einrichtungen: Gehalt
Staatlich-öffentlich finanzierte, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, etwa das Max-Planck-Institut oder die Helmholtz-Gemeinschaft, entlohnen ihre Mitarbeiter nach dem gleichen Prinzip, nur liegen mit dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) – oder darauf basierenden Hausverträgen – leicht andere Werte zugrunde.
Gehalt Wissenschaftler – nach TVöD Bund (2025)*
| EntgeltgruppeG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EG 15 |
5.669,12 |
6.039,84 |
6.453,36 |
7.017,89 |
7.598,61 |
7.980,65 |
|
EG 14 |
5.153,96 |
5.489,64 |
5.928,03 |
6.414,51 |
6.956,78 |
7.346,09 |
|
EG 13 |
4.767,62 |
5.135,53 |
5.554,35 |
6.009,06 |
6.544,14 |
6.834,50 |
*) gültig von 1.4.2025 bis 30.4.2026; alle Angaben in Euro, brutto pro Monat
Quelle: oeffentlicher-dienst.infoDiese Bindung an den Tarifvertrag ist immer wieder der Kritik ausgesetzt, weil die Gehälter im Vergleich zu Privatwirtschaft und ausländischen Hochschulen deutlich niedriger ausfallen. Die Gehaltschancen seien gerade im internationalen Vergleich zu gering, weshalb einerseits Spitzenwissenschaftlerinnen in andere Länder abwanderten und andererseits die Einkommensaussichten Forscher aus dem Ausland davon abhielten, nach Deutschland zu kommen, so die Vorwürfe.
Mit Extras im Tarifvertrag für Wissenschaftsbedienstete soll dieser Gefahr entgegengewirkt werden: Sonderzahlungen, bis zu 25 Prozent mehr Gehalt als in einer Stufe vorgesehen, oder ein besonders ausgedehnter Zeitraum, um Urlaubstage aus dem Vorjahr mitzunehmen, sind solche Maßnahmen. Die Fraunhofer-Gesellschaft beispielsweise bietet ihren Mitarbeiterinnen eine Mischung aus Festgehalt und variabler Vergütung – ein Anreiz für viele Wissenschaftler, die mit einem Blick auf die Gehälter in der Industrie schauen.
Gehalt in Research and Development in der Industrie
Ein Großteil des F&E-Personals arbeitet in der Industrie. Dort differieren die Gehälter je nach Erfahrung, Branche, Bundesland und Unternehmensgröße.
Forschung und Entwicklung: Das Einstiegsgehalt
Wer von der Uni in den Bereich Forschung und Entwicklung einsteigt, bei dem hängt der Einstiegsverdienst im Industriesektor in erster Linie vom Abschluss ab. Laut dem Gehaltsportal gehalt.de können Absolventen mit Diplom in einem naturwissenschaftlichen Bereich mit einem Anfangsgehalt von etwa 48.000 Euro rechnen. Masterabsolventinnen verdienen zu Beginn ihrer Karriere rund 46.000 Euro brutto pro Jahr, und wer einen Bachelorabschluss hat, steigt mit circa 42.000 Euro ein. Dabei handelt es sich um einen bundesweiten Durchschnitt – der individuelle Verdienst kann je nach Bundesland und Arbeitgeber variieren.
Auch die Branche entscheidet mit über den Verdienst: In der Pharmaforschung werden beispielsweise höhere Gehälter gezahlt als in der geisteswissenschaftlichen Forschung.
Forschung und Entwicklung: Gehalt nach Bundesländern und Regionen
Weil die großen Arbeitgeber der technischen Branchen wie Fahrzeug- und Maschinenbau oder Elektronik überwiegend im Süden Deutschlands sitzen und den größten Anteil am F&E-Personal beschäftigen, ist das Gehalt in Forschung und Entwicklung dort auch am höchsten.
Das bundesweite Brutto-Durchschnittsgehalt für den technischen Bereich im F&E-Segment liegt laut dem Online-Gehaltsvergleichsportal gehaltsvergleich.com bei knapp 60.000 Euro pro Jahr.
Research & Development (technisch): Gehalt nach Bundesländern 2023
| Bundesland | Jahres-Durchschnittsgehalt (in Euro) |
|---|---|
|
Baden-Württemberg |
63.900 € |
|
Bayern |
61.056 € |
|
Berlin |
54.204 € |
|
Brandenburg |
46.092 € |
|
Bremen |
55.128 € |
|
Hamburg |
56.712 € |
|
Hessen |
60.564 € |
|
Mecklenburg-Vorpommern |
44.976 € |
|
Niedersachsen |
56.256 € |
|
Nordrhein-Westfalen |
59.160 € |
|
Rheinland-Pfalz |
56.604 € |
|
Saarland |
55.704 € |
|
Sachsen |
44.460 € |
|
Sachsen-Anhalt |
46.836 € |
|
Schleswig-Holstein |
55.608 € |
|
Thüringen |
46.140 € |
Forschung und Entwicklung: Gehalt nach Unternehmensgröße
Schließlich spielt auch die Unternehmensgröße beim Verdienst eine Rolle. Bei der Betrachtung der Gehälter im technischen Forschungs- und Entwicklungsbereich wird die Diskrepanz deutlich: In Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden liegt das Gehalt von Forscher:innen und Entwickler:innen rund als 18.000 Euro über dem von F&E-Mitarbeitenden in Betrieben bis 500 Angestellten.
Große Arbeitgeber wie Bosch und VW bieten Wissenschaftler:innen attraktive und gutbezahlte Positionen im F&E-Bereich. Forschungsingenieur:innen beispielsweise verdienen laut der Gehaltsplattform Kununu bei Bosch im Jahr rund 95.000 Euro brutto; das Gehalt von Gruppenleiter:innen bei Bosch liegt im F&E-Bereich pro Jahr bei durchschnittlich rund 130.000 Euro. Entwicklungsingenieur:innen bei VW können mit einem Gehalt von rund 82.000 Euro brutto im Jahr, F&E-Leiterinnen mit einem Brutto-Jahresgehalt von deutlich über 100.000 Euro rechnen.
Das Gehalt von Wissenschaftler:innen: Überblick
Forschung und Entwicklung (F&E) in Deutschland – oft auch unter dem Fachbegriff Research and Development (R&D) geführt – vollzieht sich an Universitäten und Hochschulen, an außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in der Industrie. Generell wird beim Thema F&E zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung und experimenteller Entwicklung unterschieden.
Vor allem die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs bzw. FHs) arbeiten im Rahmen ihrer F&E-Tätigkeit mit der Wirtschaft und Politik sowie mit Partnern aus der Gesellschaft zusammen, sodass Theorie und Praxis Hand in Hand gehen. Diese Forschungstätigkeit dient zugleich als Grundlage für die Lehre und damit der Ausbildung von Studierenden.
Auch an außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AUF) wird meist anwendungsorientiert gearbeitet – auf der Grundlage von Ergebnissen aus Wirtschaft sowie Industrie und mit dem Fokus auf zukunftsweisende Technologien. In der Industrie gibt es die Grundidee, dass Wachstum nur durch eine stetige Verbesserung der wirtschaftlichen Produktionstechnologie entsteht. F&E spielen in besonders forschungsintensiven Industriebranchen daher eine große Rolle.
Wer – an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen sowie in der freien Wirtschaft – letztlich wie viel verdient, hängt auch im Wissenschaftsbereich von mehreren Faktoren ab: nicht nur von der Branche, sondern auch von den persönlichen Erfahrungswerten, vom Standort des Arbeitsplatzes, von individuellen Referenzen und vom Arbeitgeber.
Das Durchschnittsgehalt von Forschungs- und Entwicklungsingenieuren liegt – der Onlineplattform absolventa zufolge – branchenübergreifend bei ungefähr 62.000 Euro brutto im Jahr.
Promotion als Gehaltsfaktor für Forschung & Entwicklung
Zahlreiche Studien widerlegen die gängige Ansicht, dass eine Promotion nur denjenigen nutze, die eine wissenschaftliche Karriere an Hochschulen planen. Laut einer Studie der Universität Kassel verdienen Absolvent:innen mit Doktortitel eineinhalb Jahre nach der Promotion im Mittel um 40 Prozent mehr als ihre Kolleg:innen mit Masterabschluss.
30 Prozent der Promovierten arbeiteten zum Umfragezeitpunkt an einer Hochschule oder einem außeruniversitären Institut, 17 Prozent in Forschung und Entwicklung in der freien Wirtschaft und 52 Prozent in anderen Bereichen, abseits von F&E. Das durch den Doktortitel errungene Einkommensplus fällt bei Frauen allerdings um acht bis neun Prozent geringer aus als bei Männern.