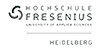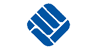Interview: Wissenschaftsmanagerin Dr. Nora Berning
„Es wäre falsch zu glauben, es gäbe nur den einen Karriereweg“

Dr. Nora Berning, Vice Director / Exexutive Director Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung © Volker Lannert
Im Interview spricht Dr. Nora Berning, Vice und Executive Director des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung, über die Vielfalt von Karrierewegen in der Wissenschaft, gutes Leadership und Chancengleichheit im deutschen Wissenschaftsbetrieb.
Aktualisiert: 29.02.2024
academics: Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich in Bezug auf den Berufsweg oder die Karriere in der Wissenschaft raten?
Dr. Nora Berning: Die Wissenschaft ist ein so großes und vielseitiges Tätigkeitsfeld, dass es falsch wäre, zu glauben, es gäbe nur den einen Karriereweg. In der Zeit, als ich selbst eine akademische Laufbahn anstrebte, habe ich mich nicht gefragt, wie realistisch es für mich ist, eine Professur zu erlangen. Solche Gedanken sind eher demotivierend, wie so manch andere Glaubenssätze, die mit einer wissenschaftlichen Laufbahn verbunden sind.
Heute bin ich als Wissenschaftsmanagerin tätig – eine Laufbahn, die sich erst aus meiner akademischen Tätigkeit heraus ergeben hat. Ich stehe täglich in Kontakt mit Nachwuchsforschenden und stelle immer wieder fest, dass die Professur als Karriereziel in den letzten Jahren an Attraktivität eingebüßt hat.
Das mag man bedauern, aber es liegt darin auch eine Chance, alternative Karrierewege zur Professur zu stärken. Hier sind die Hochschulen aufgefordert, entsprechende Anforderungs- und Aufgabenprofile offen und transparent aufzuzeigen. Eine Beratung über unterschiedliche Karrierewege findet zwar vielerorts bereits statt, allerdings handelt es sich hierbei noch zu wenig um eine strategische Karriereplanung.
Anstatt zu glauben, dass wissenschaftliche Karrieren nicht planbar sind, würde ich meinem jüngeren Ich raten, die berufliche Entwicklung an konkreten Karrierezielen auszurichten und – in Abstimmung mit der individuellen Lebenssituation – festzulegen, welche Meilensteine man in welchen Zeitabständen erreichen möchte. Ein solcher Karriereplan muss kein starres Gerüst sein, aber er kann helfen, in den entscheidenden Momenten flexibel zu handeln.
Was fasziniert Sie am Thema Leadership am meisten?
An Leadership finde ich zunächst einmal spannend, dass Führungsforschung ein gut untersuchtes Gebiet innerhalb der BWL ist. Es wird durch eine Reihe von interdisziplinären Erkenntnissen, unter anderem aus der Psychologie, den Gender Studies und angrenzenden Disziplinen, befruchtet und kommt in verschiedensten Ausprägungen daher: zum Beispiel als critical leadership studies, als digital leadership oder als female leadership.
Sicherlich hilft ein Grundwissen über Führungstheorien im Alltag, um bestimmte Situationen als Führungskraft besser bewältigen zu können. Leadership ist aber in meinen Augen auch das, was man daraus macht. Denn Leadership kann man nicht einfach so lernen.
Ich selbst bin von Hause aus Narratologin, das heißt, ich habe mich während meiner Promotion mit der Wissenschaft des Geschichtenerzählens beschäftigt. Es wird seit Jahrtausenden von Menschen genutzt, um Wissen, Erfahrungen, Werte und Emotionen weiterzugeben. Deshalb ist Storytelling auch ein wirkungsvolles Führungsinstrument. Wenn es mir als Führungskraft gelingt, die Strategie meiner Organisation in eine Erzählung zu kleiden, die von den Mitarbeitenden verstanden und im besten Fall zu ihrer eigenen wird, kann ich zukünftige Entwicklungen leichter vorantreiben.
Beispiel „Tesla“: Dort beschränkt sich die Wirksamkeit von Narrativen nicht nur auf einzelne Funktionsbereiche innerhalb des Unternehmens. Strategische Narrative sind vielmehr Kern des Geschäftsmodells. Führungskräfte, die diesen Unterschied verstanden haben und Storytelling produktiv einsetzen, sind von großem Nutzen für ihre Organisation.
Schon gewusst?
Der Zeitverlag hat ein Fellowship-Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen ins Leben gerufen: „Zia – Visible Women in Science and Humanities“ inspiriert, fördert und vernetzt Frauen in der Wissenschaft. Wer sind die Zia-Fellows? Wie, wann und wo kann ich mich als Fellow bewerben? Wie kann ich das Projekt unterstützen, als Role Model, Sponsor oder Förderer? Das und mehr erfahren Sie auf der Zia-Homepage.
Was sind Ihre Top 3 Tipps für die Leitung von interdisziplinären Forschungsgruppen?
Interdisziplinäre Forschungsgruppen stellen per se erhöhte Anforderungen an die Leitung, da es im Kern immer darum geht, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Das gelingt am einfachsten, wenn ich als Forschungsgruppenleitung die Relevanz der unterschiedlichen Perspektiven und deren Mehrwert für die Beantwortung übergeordneter Forschungsfragen permanent herausstreiche.
In der Kommunikation hilft eine gemeinsame Vision, denn ohne diese wird die Forschungsgruppe nur schwerlich eine eigene Identität entwickeln, mit der Folge, dass das Zugehörigkeitsgefühl der Forschungsgruppenmitglieder sinkt. Spitze Zungen behaupten, Interdisziplinarität bedeute mehr Arbeit für den Einzelnen. Oder, auf organisationaler Ebene betrachtet, wer Interdisziplinarität aus einem ökonomischen Effizienzgedanken heraus institutionalisiere, der verteile mehr Arbeit auf weniger Köpfe.
Hier haben Forschungsgruppenleitungen auch eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Nachwuchs: Erst wenn die Nachwuchsforschenden bereits über profunde Kenntnisse in einer Disziplin verfügen, sollten sie an interdisziplinäres Arbeiten herangeführt werden. Es braucht die Expertise der Forschungsgruppenleitung, um zu entscheiden, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist.
Schon gewusst?
Begleitend zum Fellowship-Programm „Zia – Visible Women in Science and Humanities“ gibt es einen Newsletter: Jeden ersten Samstag im Monat informieren wir Sie über Wissenswertes zum Thema Frauen in der Wissenschaft und geben Einblicke in die Zia-Community. Einfach registrieren und einen Account bei academics erstellen! Zusätzlich profitieren Sie dann von Job-Mails, Online-Seminaren, diversen Download-Möglichkeiten von Vorlagen und Handouts, dem Promotions-Test und weiteren Newslettern sowie der Job-Mail, die sie abonnieren können. Alles selbstverständlich kostenlos und nur solange Sie wollen.
Sie haben sich bereits registriert, erhalten den Zia-Newsletter bislang aber noch nicht? Loggen Sie sich in den Nutzerbereich ein – dann können Sie das Mailing unter „Benachrichtigungen“ aktivieren.
Anlässlich des Internationalen Frauentags: Was wurde bisher erreicht in der Wissenschaft und was wünschen Sie sich hinsichtlich der Zukunft?
Ich bin umgeben von Frauen in Führungspositionen, die ich für ihre wissenschaftlichen Leistungen und ihren täglichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wissenschaftsbetriebes bewundere. Besonders inspiriert haben mich die Frauen, die sich in einer männlich dominierten Fächerkultur durchgesetzt haben und sich von der gläsernen Decke nicht beirren lassen. Chapeau!
Es ist wissenschaftlich belegt, dass Chancengleichheit im deutschen Wissenschaftsbetrieb nach wie vor, trotz politischer Bestrebungen und Fördermaßnahmen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nicht gegeben ist. Dieses Thema ist jedoch derart relevant, dass ich mir für die Zukunft wünsche, dass das Erreichen einer mindestens proportionalen Vertretung von Frauen auf allen Karrierestufen nicht nur ein bloßes Lippenbekenntnis der Hochschulleitungen ist, sondern konkrete, nachweisbare Erfolge erzielt werden.
Wir können es uns als größte Volkswirtschaft der EU und als Land der Dichter und Denker schlichtweg nicht leisten, so weiterzumachen wie bisher. Es braucht ein Bewusstsein auf den obersten Leitungsebenen der Hochschulen, welchen (ökonomischen) Schaden die „leaky pipeline“, also der mit jeder Karrierestufe weiter absinkende Frauenanteil, anrichtet.
Förderangebote und Mentoring sind wichtige Bausteine, um dem entgegenzuwirken, aber sie reichen nicht aus, um die Ursache des Problems zu beheben. Wir sind als Gesellschaft insgesamt gefordert, für dieses Problem zu sensibilisieren, und sollten auch nicht die Diskurse zu den Themen Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern einerseits und Diversität andererseits gegeneinander ausspielen. Diversität bekommt zurecht gerade sehr viel Aufmerksamkeit, aber die zahlenmäßig am größten benachteiligte Gruppe in der Wissenschaft ist nach wie vor die der Frauen. Daher wünsche ich mir eine fortlaufende Debatte, die diesem Thema das nötige Gewicht für die notwendigen Veränderungen verleiht.