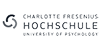Wissenschaftsethik
Ethik in der Wissenschaft: Die Rolle von Ethikrat und Ethikkommissionen

© XtockImages / iStock.com
Forschende müssen sich an ethische Prinzipien halten. Doch wie ist Wissenschaftsethik definiert, wie ist die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Forschung zu bewerten und welche Aufgaben haben Ethikkommissionen und Ethikräte?
Aktualisiert: 22.07.2025
Definition: Was ist (Wissenschafts-)Ethik?
Ethik ist heutzutage mehr als eine philosophische Disziplin: Das „ethische Verhalten des Menschen“ ist in vielen Bereichen zum Politikum geworden. Dies gilt nicht nur für Staatsoberhäupter oder Personen des öffentlichen Lebens, sondern auch für Forscherinnen und Forscher, deren Arbeitsergebnisse mehr als neue Erkenntnisse in ihrem Fachbereich mit sich bringen. Die methodisch-kritische Auseinandersetzung mit den Folgen der eigenen Forschung für die Umwelt, für andere Menschen und gesellschaftliche Werte wird heutzutage zwar vorausgesetzt. Doch zuweilen bleibt die Moral in der Wissenschaft dennoch auf der Strecke, wobei öffentlich bekannt gewordene wissenschaftliche Fehltritte nur die Spitze des Eisbergs darstellen.
Dieser Umstand begründete die Etablierung der Wissenschaftsethik als Kontrollinstrument der wissenschaftlichen Lehre und Forschung. Wissenschaftsethik befasst sich mit den ethischen Aspekten der wissenschaftlichen Forschung, stellt ethische Standards auf und rückt die gesellschaftlichen Auswirkungen von Forschungsprogrammen in den Fokus.
Warum Wissenschaftsethik?
Um die Notwendigkeit von ethischen Grundlagen in der Wissenschaft nachvollziehen zu können, ist ein Blick in die Vergangenheit nötig: Waren die technischen Errungenschaften der Industrialisierung noch bejubelt worden, so sah sich wissenschaftlicher Erfolg in späteren Jahren auch vielen Kritikern gegenüber. Denn als beispielsweise dem deutschen Chemiker Otto Hahn 1938 erstmals die Kernspaltung gelang, ebnete er der Atombombe unfreiwillig ihren Weg.
Künftig stellten sich Forschende und Nicht-Forschende die Frage: Was ist im Rahmen des wissenschaftlich Möglichen erlaubt? Gefährden bestimmte Forschungsergebnisse die Gesellschaft mehr, als dass sie ihr nutzen? Die Divergenz zwischen Machbarkeitsdenken, persönlichen Idealen und Herrschaftsinteressen prägt die Debatte um wissenschaftlichen Fortschritt bis heute. In den 1990er-Jahren rückte vor allem die Genforschung in den Fokus wissenschaftlicher Ethikdiskurse.
Forschende tragen gerade aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung eine besondere ethische Verantwortung, die über rechtliche Verpflichtungen hinausgeht. Und doch muss der Forschung stets eine gewisse Freiheit eingeräumt werden, ohne die es letztlich keinen Fortschritt geben kann.
Künstliche Intelligenz in der Wissenschaft: Ethische Aspekte
Ein zunehmend bedeutendes Thema in der Wissenschaftsethik ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Forschung und Lehre. Denn unzweifelhaft bieten KI-gestützte Systeme erhebliche Chancen, etwa bei der Analyse extrem großer Datenmengen oder bei der Literaturrecherche. Doch wo ist die Grenze? Ethische Fragen sind beispielsweise:
- Inwieweit darf künstliche Intelligenz beispielsweise beim Schreiben wissenschaftlicher Texte oder der Entwicklung von Hypothesen unterstützen – und wie muss das gekennzeichnet werden?
- Welche Daten wurden zum Trainieren der KI verwendet – gibt es hier Biases, also algorithmische Voreingenommenheiten und somit Verzerrungen oder Diskriminierungen?
- Sind sensible und personenbezogene Daten ausreichend geschützt, beispielsweise in der Medizinforschung?
- Wer ist verantwortlich für KI-generierte Inhalte?
- Sind die Ergebnisse nachvollziehbar und reproduzierbar?
- Wie müssen Lehr- und Prüfungsformate gegebenenfalls angepasst werden?
Diverse Institutionen wie die Europäische Kommission, der Wissenschaftsrat oder der Deutsche Ethikrat haben mittlerweile Positionspapiere oder Leitlinien zum bzw. für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Wissenschaft verfasst. Demnach darf der Einsatz von KI keinesfalls die wissenschaftliche Integrität gefährden – essenziell seien beispielsweise menschliche Kontrolle auf Plagiate, Verzerrungen oder Diskriminierung und eine klare Kennzeichnung, welches Tool wo wozu in welchem Umfang und zu welchem Zweck genutzt wurde. Die Verantwortung liege beim Menschen, nicht bei der Maschine.
Wissenschaftliches Fehlverhalten und gute wissenschaftliche Praxis
Von der ersten Hausarbeit bis hin zum Berufseinstieg: Studierenden wird beigebracht, sich an „gute wissenschaftliche Praxis“ zu halten. Doch in den meisten Fällen wissen sie gar nicht, was gute wissenschaftliche Praxis ist, sondern nur, was sie nicht ist: wissenschaftliches Fehlverhalten. Hausarbeiten aus dem Internet zu kopieren, sie beispielsweise von ChatGTP erstellen zu lassen oder ein zweifelhaftes Forschungsergebnis als gesichert zu verkaufen, sind zum Beispiel definitiv keine gute wissenschaftliche Praxis.
Auch kleinere wissenschaftliche Fehltritte unterhöhlen in der Summe die methodologischen und ethischen Grundprinzipien der wissenschaftlichen Forschung. Aber da sich Wissenschaftsethik mit mehr als wissenschaftlichem Fehlverhalten auseinandersetzt, reichen bloße Vorgaben für methodische Stringenz und inhaltliche Konsistenz nicht aus, um ethisches Verhalten in der Wissenschaft zu gewährleisten und die Risiken, die Forschung mit sich bringen kann, zu bewerten und zu kontrollieren.
Ethikrat und Ethikkommission: Was sind die Aufgaben?
Um ethisch korrektes Handeln im wissenschaftlichen Zusammenhang beobachten und bewerten zu können, gibt es heutzutage eine Vielzahl an Ethikkommissionen. Bereits 1964 wurden in einer Deklaration des Weltärztebundes zum Thema „Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen“ unabhängige Ethikkommissionen gefordert. Diese sogenannte Deklaration von Helsinki wurde anschließend von der Generalversammlung des Weltärztebundes verabschiedet und 1975 in Tokio bekräftigt. In Deutschland wurden 1973 erste Ethikkommission an den Universitäten Ulm und Göttingen eingerichtet.
In der Regel werden Ethikkommissionen von Universitäten, berufsständischen Vereinigungen wie Ärztekammern oder von Ländern bzw. Bundesländern gegründet. Die Hauptaufgabe dieser Kommissionen besteht vor allem in der Beratung von Wissenschaftlern in Bezug auf ethische und rechtliche Fragen ihrer Forschung. Zugleich nehmen Ethikkommissionen Kontroll- und Beobachtungsaufgaben wahr.
Der Deutsche Ethikrat
Eine der wichtigsten Ethikkommissionen in Deutschland ist der vom Bund finanzierte Deutsche Ethikrat. Dieser versteht sich vorrangig als unabhängiger Sachverständigenrat und erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen dient er als Plattform, um wissenschaftliche Spezialdiskurse zu kanalisieren. Zum anderen fungiert der Rat als „bioethisches Beratungsgremium“, das Stellungnahmen und Empfehlungen für ethisch korrektes politisches und gesetzgeberisches Handeln abgibt.
Der Ethikrat beschäftigt sich vornehmlich mit den Folgen, die die Forschung für das Individuum und die Gesellschaft haben könnte. Wichtig ist dabei auch die Zusammenarbeit und der Austausch des Ethikrates mit anderen Ethikgremien auf internationaler Ebene.
Der Deutsche Ethikrat befasst sich mit wissenschaftsethischen Fragen auf den Gebieten:
- Gesellschaft
- Naturwissenschaft
- Medizin
- Recht
Weitere Ethikkommissionen in Deutschland
Ethikkommissionen gibt es vornehmlich dort, wo geforscht wird: an den Universitäten. Dort sind sie den einzelnen Fakultäten angegliedert. Daneben gibt es eine Vielzahl an übergreifenden berufsständischen oder fachspezifischen Ethikkommissionen, beispielsweise den Ethikverband der Deutschen Wirtschaft (EVW) oder die Zentrale Ethikkommission (ZEKO) bei der Deutschen Ärztekammer.
Neben der beratenden Funktion in der Forschung spielen Ethikkommissionen auch als Prüforgane eine wichtige Rolle, etwa bei der klinischen Prüfung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Auch beim Thema Patientenschutz innerhalb humanmedizinischer Forschungen wachen Ethikkommissionen über ethisch einwandfreie Durchführung der Projekte.
Ethikantrag und Ethikvotum: Was ist das und wann sind sie nötig?
Einen Ethikantrag stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn ein von ihnen geplantes Forschungsvorhaben ethisch sensible Themen berührt. Dies gilt prinzipiell für Vorhaben, im Zuge derer mit lebenden oder bereits verstorbenen Menschen, aber auch mit identifizierbarem menschlichen Material oder sensiblen Daten gearbeitet wird. Das gilt beispielsweise auch für epidemiologischen Forschungsvorhaben. Ein weiteres ethisch sensibles Forschungsfeld stellen wissenschaftliche Projekte dar, die Tierversuche implizieren.
Das Ethikvotum, das die Ethikkommission abgibt, entscheidet mit darüber, ob geplante Forschungsvorhaben durchgeführt werden sollen. Für manche wissenschaftlichen Bereiche ist ein Ethikvotum vorgeschrieben, für andere ist dies lediglich fakultativ. Die zuständige Ethikkommission prüft nach einem Ethikantrag nicht nur das Vorhaben der Antragsteller, sondern berät die Forschenden ebenso zu relevanten ethischen und rechtlichen Fragen innerhalb ihres Forschungsvorhabens.
In der Regel wird ein Antrag an die örtlich zuständigen Ethikgremien gerichtet. Dies sind bei vielen Forschungsvorhaben die Ethikkommissionen der jeweiligen Fakultät, an der das wissenschaftliche Projekt durchgeführt werden soll. Forschende aus bestimmten Fachbereichen wie etwa der Psychologie können sich aber auch außerhalb ihrer eigenen Universität ein Ethikvotum einholen, indem sie ihren Ethikantrag beispielsweise bei der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft der Psychologie stellen.