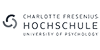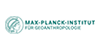Finanzierung von Forschungsprojekten
Projektfinanzierung in der Wissenschaft: Förderquellen, Ablauf und Herausforderungen

© AndreyPopov / iStock.com
Wissenschaftliche Forschung ist auf finanzielle Mittel angewiesen. Aber woher kommt das Geld, wie läuft die Finanzierung ab und welche Schwierigkeiten gibt es?
Aktualisiert: 27.10.2025
Artikelinhalt
Finanzierung in der Wissenschaft: Woher kommen die Gelder für Forschungsprojekte?
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben die öffentlichen, privaten und kirchlichen Hochschulen im Jahr 2023 insgesamt 75,2 Milliarden Euro ausgegeben. Die größten Ausgabeposten sind neben dem Personal und der Patientenversorgung im medizinischen Bereich die wissenschaftliche Forschung – und diese wird hauptsächlich über von den Hochschulen eingeworbene Drittmittel finanziert.
Größte Drittmittelgeber waren 2023 der Bund, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die gewerbliche Wirtschaft. Insgesamt beliefen sich die Drittmittel auf rund 10,7 Milliarden Euro, ein Plus von rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 3,3 Milliarden Euro kamen dabei vom Bund, knapp 3,2 von der DFG und 1,5 Milliarden Euro aus der Wirtschaft.
Forschung: wichtig, aber teuer
Forschung hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) belegt die Bundesrepublik nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Jahr 2023 im europaweiten Vergleich mit 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Rang 4, hinter Schweden, Österreich und Belgien.
Forschung ist aber gleichzeitig sehr teuer, besonders in medizinischen und naturwissenschaftlichen Fachbereichen, wo moderne Geräte für die Forschungsarbeit benötigt wird. Weil die Grundförderung, die Hochschulen von Bund bzw. Bundesländern regelmäßig erhalten, für die Deckung der Kosten nicht ausreicht, sind sie auf die Finanzierung über Drittmittel angewiesen.
Höhe der Drittmittel nach Drittmittelgeber (2023)
| Drittmittelgeber | Höhe der Drittmittel (in Euro) |
|---|---|
|
Bund |
3.323.080.000 |
|
DFG |
3.168.280.000 |
|
Gewerbliche Wirtschaft (u. dgl.) |
1.541.700.000 |
|
Europäische Union |
1.187.350.000 |
|
Stiftungen (u. dgl.) |
772.070.000 |
|
Hochschulförderungsgesellschaften |
237.440.000 |
|
Länder |
187.810.000 |
|
Sonstige öffentliche Drittmittel |
181.750.000 |
|
Int. Organisationen |
33.360.000 |
|
Gemeinden |
17.200.000 |
|
Bundesagentur für Arbeit |
2.570.000 |
Zu den Drittmitteln zählen auch Gelder, die aus Stiftungen kommen. Der Großteil der Stifter in Deutschland sind Privatpersonen, oft gründen aber auch Unternehmen Stiftungen und engagieren sich bundesweit in der Förderung von Forschung. Bedeutende Stiftungen in Deutschland, die in Wissenschaft und Forschung investieren, sind:
- VolkswagenStiftung
- Alexander von Humboldt-Stiftung
- Fritz-Thyssen-Stiftung
- Deutsche Bundesstiftung Umwelt
- Gerda-Henkel-Stiftung
Projektfinanzierung in der Wissenschaft: Der Ablauf
Gefördert wird in vielen Bereichen durch Bund, Länder und EU. Ob ein Projekt gefördert wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Innovationsgrad und den Erfolgsaussichten. Die Bundesregierung fördert grundsätzlich „konkrete FuE-Vorhaben, die den Wissensstand in zentralen Anwendungsbereichen vorantreiben und so als Wachstumstreiber in vielen Branchen wirken“. Das können Forschungsprojekte von Hochschulen, Großforschungseinrichtungen, FuE-Institutionen sowie der gewerblichen Wirtschaft sein. Darüber hinaus gibt es spezielle Programme für die Forschungs- und Innovationsförderung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Wer ein Forschungsprojekt plant und staatlich fördern lassen möchte, sollte zunächst die verschiedenen Fördermöglichkeiten identifizieren und sich bei Bedarf beraten lassen. Die Förderberatung des Bundes „Forschung und Innovation“ ist hierfür eine gute Anlaufstelle.
Die Förderrichtlinien zu den einzelnen Förderprogrammen werden als Bekanntmachungen im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darin sind Ziele, Zielgruppen, Schwerpunkte und Ablauf festgehalten. In dringenden Ausnahmefällen sind auch Förderungen für Projekte außerhalb der Bekanntmachungen möglich. Fördermittelgeber sind die Bundesministerien für Bildung und Forschung (BMBF), Wirtschaft und Energie (BMWi), Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).
Ablauf der Förderung bei Bund, DFG und Stiftungen
Der Ablauf eines Förderantrags beim BMBF gestaltet sich wie folgt:
- Identifizierung einer geeigneten Fördermöglichkeit
Nur im zweistufigen Verfahren:
- Projektskizze einreichen, diese enthält u. a.
- Bezug zum Förderprogramm
- Erläuterung der Idee und beteiligter Partner
- Darlegung des eigenen Knowhows
- Benennung bereits existierender Forschungsprojekte und -ergebnisse zum Thema
- Einschätzung von Projektlaufzeit, benötigter Ressourcen und Kosten
- Bewertung bzw. Empfehlung des Projekts durch das Ministerium/Projektträger
- Antragstellung
- Prüfung des Antrags
- Entscheidung
Antragstellung, Begutachtung, Entscheidung – so sieht der Förderungsprozess auch bei den diversen Stiftungen sowie bei der DFG aus. Bei der DFG gehen pro Jahr mehr als 13.000 Anträge auf Einzelförderung ein, also Anträge, die von promovierten Forscherinnen und Forschern zu thematisch und zeitlich begrenzten Projekten gestellt werden können. Etwa ein Drittel dieser Anträge wird bewilligt und gefördert. Im Bereich der Einzelförderung befanden sich 2020 mehr als 17.000 Projekte in der laufenden Förderung. Auf sie entfällt mehr als ein Drittel der DFG-Ausgaben. Insgesamt förderte die DFG 2022 mit rund 3,9 Milliarden Euro mehr als 31.750 Projekte.
Je sorgfältiger und detaillierter Sie Ihren Förderantrag erstellen, desto erfolgreicher ist er! Die DFG gibt Tipps.
Problemstellungen und Lösungsansätze bei der Forschungsfinanzierung
Ob Forschungsanträge von Forscher:innen finanziell gefördert werden, hängt von der Qualität und den Ergebnissen des Forschungsvorhabens ab. Das (noch) vorherrschende Bewertungssystem wird aktuell jedoch unter anderem von der Europäischen Kommission stark kritisiert und als nicht geeignet betrachtet – vor allem, weil ihm eine eher quantitative Bewertungsmethode zugrunde liegt. Denn: Die wichtigsten Indikatoren für die Bewertung sind der Journal Impact Factor (JIF – Zahl, deren Höhe den Einfluss einer wissenschaftlichen Zeitschrift wiedergibt) und die Häufigkeit, in der Forscherinnen und Forscher in Publikationen zitiert werden.
Die Europäische Kommission strebt derzeit eine grundlegende Reform dieses Bewertungssystems an. Das Ziel: Wissenschaftler:innen und deren Forschung auf Basis ihrer tatsächlichen Verdienste und Leistungen zu bewerten, nicht anhand der Anzahl ihrer Publikationen. Geplant ist eine europäische Vereinbarung, die von Unterstützern dieser Reform – darunter Organisationen der Forschungsförderung, Forschungseinrichtungen und Bewertungsbehörden – unterzeichnet wird.
Bei der Reform handelt es sich um einen komplexen, langwierigen Prozess, der auch mit Skepsis betrachtet wird. So haben sich etwa die DFG und die Helmholtz-Gemeinschaft, die in diesem Prozess die Allianz der europäischen Wissenschaftsorganisationen vertreten und den Textentwurf eng begleiten, nicht den Unterzeichnern angeschlossen. Aus ihrer Sicht seien „wesentliche Fragen unklar“, vor allem die Unabhängigkeit der Wissenschaft von der Politik und Konsequenzen einer Mitgliedschaft „hinsichtlich Reporting und Selbstverpflichtung.“
Die Wirtschaft und ihr Einfluss auf die Forschung
Viel diskutiert ist auch die Förderung durch Unternehmen und welchen Einfluss sie auf die Forschung hat. Befürworter von Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sehen die Möglichkeiten, die sich für die Forschung ergeben. Diese Drittmittel würden Forschung in vielen Fällen überhaupt erst möglich machen. Andere sind dagegen der Meinung, dass medizinische, naturwissenschaftliche und technische Fächer von der Industrie und ihren Stiftungen bevorzugt werden. Bereichen wie beispielsweise dem Umweltschutz oder sozialwissenschaftlichen Fächern fehlen hingegen finanzielle Mittel, da sie bei der Förderung durch die Wirtschaft eher vernachlässigt werden.
Dies führe nicht nur zu einseitiger Forschung. Unternehmen wird auch vorgeworfen, Einfluss auf die Forschungsergebnisse nehmen zu wollen, wodurch die Unabhängigkeit der Forschung gefährdet wäre. Unklar ist darüber hinaus auch, wem die Ergebnisse der Forschungsarbeit gehören.