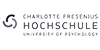Motivationsschreiben Bewerbung
Was ist die „Dritte Seite“ der Bewerbung?

Das Motivationsschreiben ist ein essenzieller Teil mancher Bewerbungen © Pheelings Media / iStock.com
Bei manchen Bewerbungen, beispielsweise für eine Promotion an einer Graduiertenschule oder bei einer Stiftung, ist das Motivationsschreiben das wichtigste Element. Lesen Sie hier, was ein Motivationsschreiben beinhalten sollte – und was der Unterschied zum Anschreiben ist.
Aktualisiert: 06.01.2025
Artikelinhalt
Was ist ein Motivationsschreiben – und der Unterschied zum Anschreiben?
Das Motivationsschreiben ist nicht zu verwechseln mit dem Bewerbungsanschreiben. Während letzteres dazu dient, die eigene Expertise und fachliche Eignung für die ausgeschriebene Stelle kurz anzureißen, werden auf der sogenannten „Dritten Seite“ einer Bewerbung die persönlichen Beweggründe basierend auf dem Lebenslauf, den Stärken und Interessen des Bewerbers oder der Bewerberin ausführlicher und überzeugend dargelegt. Es soll nicht nur die hohe intrinsische Motivation des bzw. der Kandidat:in für die ausgeschriebene Stelle belegen, sondern auch aufzeigen, dass er oder sie diese perfekt ausfüllen wird.
Nicht bei jeder Bewerbung ist ein Motivationsschreiben gefordert; waren Motivationsschreiben für eine Promotion noch vor zehn Jahren eher unüblich, bilden sie heutzutage neben dem Exposé ein Kernstück der Bewerbung um eine Promotionsstelle an einer Hochschule. Dies gilt laut Thesis e. V., dem deutschlandweiten Netzwerk für Promovierende und Promovierte, insbesondere für Graduiertenschulen und die Promotion an Forschungseinrichtungen. Auch Stiftungen und NGOs fordern häufig ein Motivationsschreiben. Bei Industriepromotionen und bei Promotionen, die von einem Hochschulinstitut ausgeschrieben werden, werden Motivationsschreiben zwar nicht immer explizit verlangt – dennoch rundet ein solches Schriftstück eine gute Bewerbung ab und sollte daher mit der notwendigen Sorgfalt verfasst werden. Wie wichtig solch ein Schreiben im Einzelfall ist, hängt nicht nur von der jeweiligen Hochschule ab, sondern kann sich auch innerhalb der einzelnen Fachbereiche unterscheiden.
Inhalt und Aufbau des Motivationsschreibens
Das Motivationsschreiben beinhaltet die Kontaktdaten des Bewerbers oder der Bewerberin sowie idealerweise den Stellencode der Ausschreibung. Es folgt die Überschrift „Motivationsschreiben“, gegebenenfalls mit einer definierten Frage- beziehungsweise Themenstellung, ein einleitender Absatz, der Hauptteil und der Schluss. In der Regel wird das Dokument in einem Fließtext formuliert. Auf diese Weise kann die eigene Motivation besser begründet werden. Darüber hinaus wirkt ein Fließtext persönlicher, er lässt sich auf die potenzielle Promotionsstelle genauer zuschneiden.
Im Folgenden führen wir aus, wie Inhalt und Aufbau eines Motivationsschreibens für eine Promotionsstelle aussehen sollten. Für Bewerbungen bei einer NGO oder Stiftung kann dies übertragen werden.
Einleitung
In der kurzen Einleitung des Motivationsschreibens sollte der oder die angehende Doktorand:in darlegen, welche Forschungs- und Interessenschwerpunkte er bis zum Erreichen des aktuellen akademischen Grades bearbeitet hat.
Hauptteil
Im ausführlichen Hauptteil beschreibt und begründet der oder die Bewerber:in den Antrieb, die ausgeschriebene Stelle oder das Promotionsprogramm wahrnehmen zu wollen. Hervorgehoben werden soll die intrinsische Motivation, in diesem Forschungsbereich die persönliche Zukunft zu sehen. Die Forschungsinteressen können an dieser Stelle tiefergehend erläutert werden. Daraus sollte sich ergeben, warum eine Promotion gerade in diesem Projekt angestrebt wird.
Hier eignen sich greifbare Beispiele. Das kann der persönliche Bezug zu dem Land sein, über dessen Gesellschaft der:die Kandidat:in jetzt promovieren will. Oder auch beispielsweise die Leidenschaft für Technik, die er oder sie während eines freiwilligen Engagements entdeckte und die ihn oder sie jetzt zu einer Karriere in der Forschung antreibt.
Wichtig ist aber auch, nicht nur sich selbst darzustellen, sondern auch die Arbeit und die Schwerpunkte des Fachbereichs in das Schreiben einfließen zu lassen. Es sollte also daraus hervorgehen, wie sich das anvisierte Projekt in bereits bestehende Forschungsschwerpunkte einfügen lässt und welche Anknüpfungspunkte zu anderen Forschungsthemen und -projekten möglich sind. Ist ein Promotionsthema vorgegeben, sollten Kandidat:innen ihre bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet sowie die beabsichtigten Forschungsaktivitäten auf der angestrebten Stelle ausführlich darlegen, dabei aber nicht zu sehr ausschweifen.
Neben der beabsichtigten Qualifizierung zur Promotion sollte aus dem Motivationsschreiben zudem hervorgehen, dass der Kandidat oder die Kandidatin sich auch für andere Aufgaben und Chancen interessiert, die die Promotionsstelle oder das Programm bietet – wie die Lehre, eine Gruppenleitung, die Teilnahme an Konferenzen oder die Möglichkeit der Publikation.
Schluss
Der Schluss des Motivationsschreibens besteht aus einem kurzen Ausblick, was mit der Promotion und der Dissertation erreicht beziehungsweise bewirkt werden soll sowie der handschriftlichen (!) Unterschrift. Abschließende Floskeln sind an dieser Stelle genauso überflüssig wir leere Phrasen und Allgemeinplätze im gesamten Motivationsschreiben.
Schon gewusst?
Sie sind noch unschlüssig, ob Sie promovieren sollten? Finden Sie es heraus! Als registrierte:r Nutzer:in können Sie kostenlos den Promotions-Test machen, den wir gemeinsam mit dem Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg entwickelt haben.
Umfang des Motivationsschreibens
Für den Umfang eines Motivationsschreibens gibt es keine generellen Vorgaben. Bei einigen Doktorandenstellen kann eine Seite ausreichen, bei komplexeren Sachverhalten darf das Schriftstück laut Thesis e. V. aber auch bis zu fünf Seiten umfassen, sofern dieser Umfang aus Gründen der Vollständigkeit erforderlich ist. In der Regel wird die maximale Länge in der Stellenausschreibung vorgegeben.
Weitere Tipps für das Verfassen eines Motivationsschreibens
Thesis e. V. empfiehlt zuallererst, dass sich Bewerber:innen vor dem Verfassen des Motivationsschreibens persönlich bei dem jeweiligen Institut bzw. Arbeitgeber erkundigen sollte, welche Rolle dieses Schriftstück im Zuge der Bewerbung einnehmen und was dort im Einzelnen behandelt werden soll. Durch diese Vorgehensweise vermeiden Kandidat:innen den Eindruck, dass es sich um eine Standardbewerbung handelt, die für verschiedene Stellenausschreibungen verwendet wird.
Weitere Tipps für das Verfassen eines Motivationsschreibens:
- Bewerber:innen sollten ihr Motivationsschreiben – soweit möglich – auf die Herausforderungen der angebotenen Stelle anpassen. Dazu gehört, sich zu informieren, welche Ziele das Promotionsprogramm verfolgt und auf die fachlichen und persönlichen Auswahlkriterien einzugehen. Sind also beispielsweise interdisziplinäre Herangehensweisen gefragt oder Promotionsprogramme international angelegt, ist es sinnvoll, eigene fächerübergreifende Erfahrungen oder Sprachkenntnisse in den Vordergrund zu stellen.
- Bewerber:innen sollten ihre Selbsteinschätzungen zudem belegen können, wo es möglich ist. Attestiert sich ein:e Kandidat:in beispielsweise eine hohe generelle Eigenmotivation oder überdurchschnittliches Engagement, sollte er oder sie diese Angaben mit einem Verweis auf sein soziales oder gesellschaftliches Engagement unterstreichen.
- Bewerber:innen sollten sich an das Fachvokabular halten, um zu unterstreichen, dass sie tief im entsprechenden Thema verwurzelt sind. Sie sollten sich aber trotzdem klar und verständlich ausdrücken.
- Ein Motivationsschreiben gehört bei der elektronischen Bewerbung in den Anhang und sollte kein Teil des Anschreibens in der E-Mail sein. Zudem sollte der Adressat exakt der sein, der auch in der Stellenausschreibung angegeben wurde.
- Die korrekte Rechtschreibung ist laut Thesis e. V. ein besonders wichtiger Punkt: Wer schon im Motivationsschreiben Fehler macht, lässt mutmaßlich auch beim wissenschaftlichen Arbeiten die nötige Genauigkeit vermissen. Viele Tipp- oder Rechtschreibfehler können also ein zusätzlicher Grund für eine Ablehnung sein.