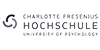Exposé schreiben
Wie schreibt man ein Exposé für die Dissertation?

Das Exposé ist der erste Schritt Richtung Doktortitel. © Michael Edwards / iStock.com
Wer eine Doktorarbeit schreiben will, muss ein Exposé vorlegen. Es sollte die wissenschaftliche Eignung des Kandidaten oder der Kandidatin belegen und ist eine wichtige Vorarbeit für eine erfolgreiche Promotion.
Aktualisiert: 04.03.2024
Das Exposé einer Doktorarbeit: Was ist das?
Bevor Doktoranden und Doktorandinnen ihre Promotion angehen können, müssen sie ein Exposé für die Dissertation an der Hochschule einreichen. Wer sich für finanzielle Unterstützung der Doktorarbeit, zum Beispiel im Rahmen eines Forschungsstipendiums, bewirbt, braucht auch dafür ein Exposé.
In diesem Dokument legen die angehenden Promovend:innen dar,
- welches Thema sie bearbeiten wollen,
- welche Ansätze und Quellen sie nutzen wollen und
- warum das Thema relevant für die Forschung ist.
Im Grunde gleicht das Exposé einer Dissertation also einem wissenschaftlichen Projektplan, der als wichtiges Element auch einen Zeitplan beinhalten soll. Da das Dokument bereits ganz zu Beginn der Recherche verfasst wird, hat es aber nicht den Anspruch, eine Kurzversion der späteren Dissertation zu sein. Wichtig ist, dass es den oder die Promotionsbetreuenden oder den Promotionsausschuss von der Relevanz des Forschungsprojektes überzeugen kann.
Neben der Zielsetzung des Exposés, einen Doktorvater oder eine Doktormutter beziehungsweise eine Promotionsstelle zu bekommen, erfüllt es jedoch auch für die zukünftigen Doktoranden oder die Doktorandin eine wichtige Funktion: Sie dient auch der eigenen Strukturierung. Da sich angehende Promovierende beim Verfassen des Exposés notwendigerweise intensiv mit dem Thema, der Herangehensweise und einem Zeitplan beschäftigen, wird das Vorgehen auch für sie selbst klarer.
Im Exposé muss die Quellenlage und die wichtigste Literatur zum Thema angegeben werden. Es ist also sinnvoll, bereits in diesem Stadium mit der Recherche zu beginnen.
Verfassen eines Exposés: Die ersten Schritte
Bei der Erarbeitung des Exposés sollten Promovierende präzise und systematisch vorgehen, um keinen wichtigen Bestandteil zu vergessen. Die Leser:innen sind schließlich Wissenschaftler:innen und fachliche Expert:innen, die nicht nur den forschungsrelevanten Gehalt des Projekts, sondern auch dessen Machbarkeit bewerten.
Dissertationsthema eingrenzen und seine Relevanz darlegen
Der erste und wichtigste Schritt ist, das richtige Dissertationsthema zu finden. Im Exposé muss die leitende Fragestellung und Zielsetzung des Dissertationsvorhabens klar werden. Egal, ob der politische Widerstand in Francos Spanien oder die Synthese von Metalloxidmaterialien beleuchtet wird, die Eckpunkte für die Legitimation eines Themas sind fast immer dieselben: Neben einer thematischen Abgrenzung sind vor allem die Einordnung in die Forschungslandschaft sowie die Aktualität und Relevanz des Themas entscheidend.
Zukünftige Doktorand:innen müssen deshalb schlüssig belegen, wo sie die bestehende Lücke in der Forschung sehen und warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die von ihnen aufgeworfene Fragestellung umfassend zu untersuchen. Je nach Disziplin kann zusätzlich die Entwicklung von Hypothesen ein wichtiger Bestandteil des Exposés sein.
Wichtig ist, dass das Exposé an den Forschungsschwerpunkten der Hochschule, des Lehrstuhls oder der Graduiertenschule ausgerichtet ist. Nur wenn das Projekt dazu passt, hat die Bewerbung Aussicht auf Erfolg. Auch im Exposé sollte bereits wissenschaftlich gearbeitet werden – Fußnoten und Verweise auf Quellen inklusive.
Schon gewusst?
Sie sind noch unschlüssig, ob Sie promovieren sollten? Finden Sie es heraus! Als registrierte:r Nutzer:in können Sie kostenlos den Promotions-Test machen, den wir gemeinsam mit dem Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg entwickelt haben.
Forschungsmethode benennen und ihren Einsatz begründen
Im Exposé wird zudem üblicherweise bereits die Methode dargelegt, mit der das Forschungsobjekt untersucht werden soll. Denn: Eine gut gewählte Methode ist die Grundlage für eine erfolgreiche Dissertation. Das Exposé sollte schlüssig begründen, welche Methode oder Theorie verwendet wird und wie die Hypothesen überprüft werden.
Während im empirischen Teil der Arbeit inhaltlich Neues zutage treten muss, muss in Bezug auf die Methode das Rad nicht zwingend neu erfunden werden. Es lohnt sich also, zu recherchieren, wie andere Forschende in den vergangenen Jahren ähnliche Fragestellungen angegangen sind. Es ist durchaus legitim, sich im Forschungsexposé auf die Vorgänger:innen zu beziehen. Damit lässt sich nicht nur viel Zeit sparen – Doktorand:innen können so auch belegen, dass sie wissenschaftliche Prozesse verstehen.
Aufbau und Inhalt des Exposé
Der Aufbau eines Exposés kann sich je nach Fachbereich und Forschungsprojekt stark unterscheiden. Als Beispiel kann aber folgende Gliederung dienen:
- Deckblatt
- Forschungsfrage
- Aktueller Forschungsstand
- Theoretischer Hintergrund
- Zielsetzung
- Forschungsdesign und Methodik
- Zeit- und Arbeitsplan
- Bibliographie
Wie jede wissenschaftliche Arbeit dieser Größenordnung sollte das Exposé mit einem Deckblatt beginnen. Dort stehen Informationen zur Person (Name, Geburtsdatum, Email-Adresse, Anschrift, Telefonnummer) sowie ein vorläufiger Titel des Dissertationsprojekts.
Der inhaltliche Teil beginnt mit den bereits skizzierten Aspekten zu Forschungsfrage, Forschungsstand, Theorie und Methodik. Es versteht sich von selbst, dass eine Gliederung zu diesem Zeitpunkt nur vorläufig ist. Niemand weiß, was die Laborergebnisse aussagen, welche Überraschung im Archiv wartet oder wie ergiebig die Interviews sind, auf denen die Dissertation basiert. Dennoch ist eine gut durchdachte Gliederung mit einem schlüssigen Zeitplan wichtig für die Bewertung des Dissertationsprojekts.
Das Forschungsexposé endet mit einer Bibliographie aller im Text zitierten Quellen. Es bietet sich an, diese Liste durch wichtige Texte aus dem Forschungsbereich zu ergänzen. Im Idealfall haben angehende Doktorand:innen diese Bücher und Aufsätze nicht nur schon identifiziert, sondern bereits mit deren Lektüre begonnen. Denn es kann durchaus sein, dass im Vorstellungsgespräch Fragen zum Stand der Forschung kommen.
Der Zeitplan muss angemessen und realistisch sein
Wer sich an einer Graduiertenschule bewirbt, sollte berücksichtigen, dass dort oft der Doktortitel innerhalb von drei bis vier Jahren erreicht werden soll. Sollte schon im Exposé deutlich werden, dass ein solcher Zeitplan utopisch ist, wird die Bewerbung mit großer Wahrscheinlichkeit abgelehnt.
Auch an anderen Hochschulen sollte bei einer Vollzeitpromotion die Dauer auf drei Jahre ausgerichtet sein – das empfehlen auch der Wissenschaftsrat und die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Wer eine nebenberufliche Promotion und deshalb einen längeren Zeitraum anstrebt, sollte das transparent und explizit darstellen. Ein Konzept mit konkreten Arbeitsschritten zur Beantwortung der Fragestellung oder zur Überprüfung der Hypothesen hilft dabei, einen realistischen Zeitplan zu entwerfen.
Tipps und Beispiele für gute Exposés
Einer der wichtigsten Ratschläge für das Erstellen eines Forschungsexposés ist, sich so viel Zeit wie möglich dafür zu nehmen – es ist schließlich nicht weniger als die Grundlage der Dissertation.
Auch auf Sprache und Stil sollte großer Wert gelegt werden. Ganz grundlegend gilt: Das Exposé sollte in derselben Sprache wie die spätere Doktorarbeit verfasst werden. Weil das Foschungsexposé für die Prüfenden auch den Beweis erbringen soll, dass der angehende Doktorand oder die angehende Doktorandin zu wissenschaftlichem Arbeiten in der Lage ist, sollte das Dokument objektiv, präzise und verständlich formuliert werden. Hier finden Sie mehr Tipps für gutes wissenschaftliches Schreiben.
Außerdem sind Angaben aus der Theorie oder dem Forschungsstand sorgfältig mit Quellenangaben zu versehen. Hier sollten sich Promotionskandidat:innen auch an den Konventionen ihres Faches orientieren, vor allem, was sprachliche Besonderheiten, Terminologien sowie formale Richtlinien betrifft. Im Zweifel kann auch zu diesem Thema Rücksprache mit der Betreuungsperson, dem:der Vorsitzenden des Promotionsausschusses oder der Fakultätsleitung gehalten werden. In allen Fachdisziplinen sind jedoch klare und eindeutige Satzgefüge wichtig. Zudem sollten Promovierende auf eine gendergerechte Sprache achten.
Beispiele aus der Praxis
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ein Exposé aussehen sollte, ist es am besten, sich Beispiele wie dieses Exposé zum ethischen Leser auf Researchgate. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg hat eine Vorlage ins Netz gestellt, die Promovierenden ihres Fachbereichs bei der Erstellung des Forschungsexposés helfen kann.
Es lohnt sich auch, andere Promovierende anzusprechen oder im eigenen Fachbereich um Einsicht in bisher eingereichte Forschungsexposés zu bitten. Auch in Doktorandennetzwerken können Ansprechpartner:innen bereit sein, Beispiele von Exposés zur Verfügung zu stellen oder Tipps zu geben.