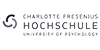Doktorvater/Doktormutter finden
Promotion: Den passenden Doktorvater oder die passende Doktormutter finden
- Doktorvater oder Doktormutter bezeichnet die betreuende Person einer Dissertation. Sie ist für jede Promotion erforderlich.
- Eine zielgerichtete Recherche nach Professor:innen mit passenden Forschungsschwerpunkten zum Promotionsthema ist essenziell.
- Ein klar formuliertes und gut vorbereitetes Exposé erleichtert die Kontaktaufnahme und überzeugt potenzielle Betreuer:innen.
- Persönliche und fachliche Kompatibilität zwischen Promovend:in und Betreuer:in ist entscheidend für den Erfolg der Promotion.
Aktualisiert: 09.01.2026
Doktorvater und Doktormutter: Was ist das?
Doktorvater oder Doktormutter sind inoffizielle, aber überaus gebräuchliche Bezeichnungen für die Betreuenden einer Promotion. Sie sind die zentralen Ansprechpartner:innen und Motivator:innen, tragen das Promotionsvorhaben ihrer Schützlinge mit und helfen bei fachlichen und oft auch bei persönlichen Problemen weiter. Außerdem nehmen sie den Doktorand:innen die Prüfungen am Ende der Promotion ab.
Wer eine Promotionsstelle an einer Universität annimmt, muss sich in der Regel nicht um eine Doktormutter oder einen Doktorvater bemühen: Die Betreuung der Promotion durch eine Professorin oder einen Professor ist hier meist bereits eingeplant. Gleiches gilt für ein strukturiertes Promotionsprogramm. Auch hier werden den angehenden Doktorand:innen im Allgemeinen passende Doktorväter oder -mütter an die Hand gegeben.
Doktorandinnen und Doktoranden, die klassisch individuell promovieren, müssen sich jedoch selbst auf die Suche nach einer Betreuungsperson begeben. Und das ist nicht immer einfach – vor allem dann nicht, wenn keine persönlichen Kontakte (mehr) zu einer Universität bestehen, an die angeknüpft werden kann. Hier kommen Tipps, wie die Suche gelingt.
Wer darf Doktorvater oder -mutter sein?
Wer diese Aufgabe übernehmen darf, ist in der Promotionsordnung der jeweiligen Fakultät geregelt. In erster Linie dürfen – beziehungsweise müssen – Professor:innen die Promovierenden betreuen. Auch andere habilitierte Mitglieder einer Universität, also Privatdozentinnen und Privatdozenten, können diese Aufgabe übernehmen.
Mitglieder außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und Bildungsstätten können ebenfalls in der Regel unter bestimmten Bedingungen als Doktorväter oder -mütter fungieren. Die Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg beispielsweise schreibt vor, dass es eine entsprechende Kooperation zwischen der Universität und der Forschungs- oder Bildungseinrichtung geben muss.
Auch bei der Medizinischen Fakultät Charité der Universität Berlin können außerplanmäßige Professor:innen und Privatdozent:innen, die nicht dort beschäftigt sind, Doktormütter oder -väter sein, „wenn eine ordnungsgemäße Betreuung des Promotionsvorhabens bis zu seinem Abschluss gewährleistet ist“. Durch Auswahlverfahren bestimmte unabhängige promovierte Nachwuchsgruppenleiter:innen können hier ebenfalls die Betreuung Promovierender übernehmen.
Regelmäßige Treffen und bestmögliche Förderung sind Pflicht
Ebenfalls in den Promotionsordnungen geregelt sind die Pflichten, die ein Doktorvater oder eine Doktormutter mit der Betreuung erfüllen muss. So schreibt beispielsweise die Charité vor: „Die betreuenden Personen sind verpflichtet, bei der Betreuung kollegial zusammenzuwirken, sich mit der promovierenden Person regelmäßig zu Betreuungszwecken zu treffen und die wissenschaftliche Qualität der Arbeit der promovierenden Person zu befördern. Die Gesamtzahl der gleichzeitig erstbetreuten Promotionen pro betreuender Person sollte zehn nicht überschreiten.“
Schon gewusst?
Sie sind noch unschlüssig, ob Sie promovieren sollten? Finden Sie es heraus! Als registrierte:r Nutzer:in können Sie kostenlos den Promotions-Test machen, den wir gemeinsam mit dem Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg entwickelt haben.
Promotionsbetreuer:in suchen: Worauf kommt es an?
Die Suche nach einem oder einer Betreuenden ist eng mit der nach einem Dissertationsthema verbunden. Denn: Der Doktorvater oder die Doktormutter sollte auf dem Gebiet der Forschungsfrage über Expertenwissen verfügen. Schließlich müssen die Betreuenden dem Doktoranden oder der Doktorandin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der oder die Betreuende muss also vor allem eines sein: fachlich kompetent.
Doch damit die Zusammenarbeit zu einem guten Ergebnis führt, ist es von großem Vorteil, wenn die Chemie zwischen der betreuenden und der promovierenden Person stimmt. Wer sich „nicht riechen“ kann, wird weniger motiviert sein, regelmäßig produktive Gespräche zu führen. Gibt es vonseiten der Betreuenden zu wenig Unterstützung, kann dies im Laufe der mehrere Jahre währenden Promotion zu großer Frustration oder sogar einem Promotionsabbruch führen. Auch das Gegenteil kann die Motivation für die Promotion schmälern und so den Erfolg gefährden: Wenn die Promotionsbetreuenden versuchen, zu viel Einfluss zu nehmen und den eigenen Stempel auf die Forschungsarbeit aufzudrücken.
Genau über infrage kommende Betreuende informieren
Deshalb empfiehlt es sich, sich vorher zu informieren: Welchen Ruf hat die betreuende Person an der Hochschule? Wer an der eigenen Universität promovieren möchte, kennt die infrage kommenden Betreuenden in der Regel. Schwieriger wird dies, wenn die Dissertation an einer anderen Hochschule geschrieben werden soll. Hier zahlt sich gutes Netzwerken schon während des Masterstudiums aus: Bekannte im Fachbereich wissen vielleicht, welchen Ruf der favorisierte Doktorelternkandidat hat. Auch die Mitarbeiter der eigenen Fakultät können oft weiterhelfen.
Alternativ sind die Doktoranden-Netzwerke an den Universitäten oder auch der Verein Thesis e.V., ein interdisziplinäres Netzwerk von Promovierenden und Promovierten, ein guter Ansatzpunkt.
Abzuklären ist:
- Nimmt die betreuende Person sich für gewöhnlich ausreichend Zeit für die Betreuten?
- Schließen die Doktorandinnen ihre Promotion in der Regel in der vorgesehen Zeit ab? Wenn nein: Warum nicht?
- Ist die Abbruchquote bei dem oder der Betreuenden ungewöhnlich hoch?
- Vergibt die betreuende Person häufig Bestnoten, auch für mit Minimalaufwand geschriebene Dissertationen? Das könnte die weitere akademische Karriere in der Postdoc-Phase erschweren.
Sind die erhaltenen Auskünfte eher negativer Art, ist es ratsam, sich um eine andere Doktormutter zu bemühen.
Anschreiben, Exposé und Vorgehensweise
Welche:r Wissenschaftler:in ist für die Betreuung des geplanten Dissertationsthemas geeignet? Wer gilt vielleicht sogar als Koryphäe? Hilfe bei dieser Frage bieten folgende Internetplattformen:
- Hochschulkompass: Hier können angehende Promovierende nach Promotionsmöglichkeiten in Deutschland suchen – gezielt nach Fachbereichen, Studiengängen, Forschungsschwerpunkten und auch der Promotionsart.
- GERiT – German Research Institutions: Die Plattform enthält Daten zu fast 30.000 Forschungseinrichtungen in Deutschland. Es kann nach Standorten und Fächern gesucht werden.
- PhD Germany: Die Datenbank des Deutschen Akademischer Austauschdienst (DAAD) bietet einen Überblick über Promotionsmöglichkeiten an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Wenn geeignete potenzielle Betreuende ausgemacht sind, gilt es, Kontakt aufzunehmen – und zwar am besten persönlich per Telefon oder auch E-Mail. Hier sollte das Forschungsvorhaben möglichst konkret skizziert und um einen Gesprächstermin gebeten werden – ein Gespräch ist in der Regel erfolgversprechender als lange Bewerbungsschreiben, deren Lektüre die Professorin oder den Professor viel Zeit kostet. Außerdem lässt sich in einem persönlichen Gespräch am besten erfahren, ob die Chemie stimmt.
Möglicherweise wird die betreuende Person darum bitten, vorab Bewerbungsunterlagen zugesandt zu bekommen. Alternativ werden diese zum Gespräch mitgebracht.
In die Bewerbungsunterlagen gehören:
- ein Anschreiben
- ein Lebenslauf
- Zeugnisse und
- eventuell bereits ein Exposé, in dem das Forschungsvorhaben möglichst konkret geschildert wird.
Weitere Tipps für die Bewerbungsunterlagen:
- Professorinnen und Professoren haben in der Regel wenig Zeit. Die Bewerbung sollte möglichst knapp und auf den Punkt formuliert werden.
- Lehrende sind nicht darauf angewiesen, eine weitere Promotion zu betreuen. Auf eine höfliche Ansprache sollte geachtet werden – aufdringlich sollte man aber nicht wirken, das könnte ein Ausschlusskriterium sein.
- Standardanschreiben sind zu vermeiden. Die Bewerbung muss exakt und individuell auf die freie Promotionsstelle und das Forschungsgebiet der betreuenden Person zugeschnitten sein. Wer über deren Forschungsergebnisse und Forschungsvorhaben informiert ist, sammelt meist zusätzliche Pluspunkte. Es sollte klar dargelegt werden, warum genau sie die richtige für ihr Vorhaben ist und welche Vorteile sie durch die Zusammenarbeit hätte.
- Die Unterlagen müssen vollständig sein – am besten gezielt nachfragen, was erforderlich ist –, außerdem ist auf die korrekte Form und Rechtschreibung zu achten.