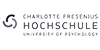Strukturierte Promotion
Ob Graduiertenkolleg, Graduiertenschule oder an der Uni: Was ist eine strukturierte Promotion?

Strukturierte Promotionsprogramme sind besonders für ausländische Doktorand:innen interessant © Drazen Zigic / iStock.com
Strukturierte Promotionsprogramme bieten feste Laufzeiten, eine individuelle Betreuung und gesicherte Finanzierung. Welche Möglichkeiten zur strukturierten Promotion gibt es?
Aktualisiert: 27.11.2024
Strukturierte Promotion: Definition
Neben der individuellen Promotion, bei der Promovierende größtenteils selbst für das Thema, die Zeiteinteilung, Zwischenziele und die Finanzierung verantwortlich sind, bietet sich Doktorand:innen auch die Möglichkeit, über ein strukturiertes Promotionsprogramm zum Doktortitel zu gelangen. Eine stetig wachsende Zahl an Wissenschaftler:innen in frühen Karrierephasen entscheidet sich für diesen Weg. Anders als das traditionelle Modell bietet die strukturierte Promotion ein festes Curriculum mit individueller Betreuung, fester Laufzeit und geregelter Finanzierung.
Strukturierte Promotionsprogramme sind auch und besonders für ausländische Doktorand:innen interessant, denn sie bekommen Hilfe bei Alltagsproblemen – wie bei der Kontoeröffnung, der Wohnungssuche oder der Organisation gemeinsamer Freizeitaktivitäten – bis hin zu einer intensiven Betreuung durch die Hochschule. Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung promoviert etwa jede:r vierte internationale Doktorand:in in strukturierten Promotionsprogrammen.
In Deutschland gibt es ein großes Angebot, um strukturiert zu promovieren. Die gängigsten Möglichkeiten sind
- Graduiertenschulen,
- Graduiertenkollegs und
- Promotionsstudiengänge an Universitäten.
Zur Abgrenzung der Begrifflichkeiten: Promotionsstudiengänge an Universitäten orientieren sich stark am klassischen Studium. Sie bieten Doktorand:innen einen zumeist sehr flexiblen Stundenplan, der es ihnen beispielsweise auch ermöglicht, Beruf und Promotion miteinander zu vereinen. Finanziell gefördert werden Promotionsstudiengänge für gewöhnlich nicht.
Während an den Graduiertenkollegs in eher kleinen Gruppen zu sehr fokiussierten Fragestellungen und Projekten geforscht wird, arbeiten an Graduiertenschulen internationale Forscher:innen aus äußerst unterschiedlichen Fachgebieten zusammen. Die Wissenschaftler:innen arbeiten zwar an ihren eng gefassten Fragestellungen, insgesamt werden in Graduiertenschulen aber übergeordnete, weitreichende Themenkomplexe erforscht, manchmal auch fakultätsübergreifend.
Strukturierte Promotionsprogramme
| Promotionsstudiengang | Graduiertenkolleg | Graduiertenschule | |
|---|---|---|---|
|
Geregelte Finanzierung |
keine |
E13-Stellen (65 bis 100 Prozent) |
Stipendien (Höhe variiert) / Promotionsstellen |
|
Zahl der Doktoranden |
zwischen 20 und 50* |
10 bis 20 |
bis zu mehrere hundert |
|
Forschungsthema |
nach universitären Fachbereichen gegliedert |
eng gefasst; stark spezialisiert |
weit gefasst; fakultätsübergreifend |
|
Arbeitssprache |
deutsch** |
englisch |
englisch |
*) Durchschnittliche Anzahl ; **) Gilt für den Großteil der Promotionsstudiengänge in Deutschland. Die Arbeitssprache Englisch setzt sich aber zunehmend durch. Internationale Studiengänge werden meist in den Lehrsprachen Deutsch und Englisch abgehalten.
Quelle: academics @academicsStrukturierte Promotion an Graduiertenschulen
Große internationale Forscherteams und interdisziplinäre Doktorandengruppen: Graduiertenschulen sind Orte des gegenseitigen Austauschs und gemeinsamen Fortschritts.
Graduiertenschulen in Deutschland
Die meisten der insgesamt 79 Graduate und Research Schools in Deutschland sind an deutsche Universitäten angegliedert. Hier können sich Wissenschaftler:innen ein exzellentes berufliches Netzwerk aufbauen und sich austauschen. Ein Beispiel hierfür ist die Göttinger Graduiertenschule für Neurowissenschaften und Molekulare Biowissenschaften (GGNB), die zu den größten Graduiertenschulen in Deutschland zählt.
Vier Fakultäten der Universität Göttingen, zwei Max-Planck-Institute und das Deutsche Primatenzentrum forschen hier gemeinsam in den Bereichen der Hirn- und Verhaltensforschung, Biochemie, Biophysik sowie der Zell- und Entwicklungsbiologie. Die Doktorand:innen arbeiten innerhalb der Forscherteams nicht nur für sich, sondern sind an übergeordneten Forschungsprojekten beteiligt. „Unsere 350 Doktoranden, von denen bis zu 45 Prozent aus dem Ausland kommen, sind direkt in die Forschergruppen eingebunden“, unterstreicht der wissenschaftliche Koordinator der GGNB, Dr. Steffen Burkhardt.
Außeruniversitäre Initiativen und Einrichtungen
Einige relevante strukturierte Promotionsprogramme sind zwar nicht an universitäre Einrichtungen gebunden, kooperieren aber mit Hochschulen – wie etwa die International Max Planck Research Schools (IMPRS), von denen es 68 gibt. Hier haben deutsche und ausländische Doktorand:innenen die Möglichkeit, im Rahmen einer dreijährigen Doktorandenausbildung zu interdisziplinären Themen zu forschen und zu promovieren.
Gut zu wissen: Das Promotionsrecht in Deutschland liegt bei den Universitäten (auch wenn in einigen Bundesländern mittlerweile auch HAWs/FHs mindestens ein eingeschränktes Promotionsrecht haben). Doktorand:innen an einer Max Planck School werden daher an einer universitären Fakultät promoviert. Eine Auflistung aller Max Planck Research Schools sowie Informationen zur Bewerbung finden Promotionsinteressierte auf der Webseite der Max-Planck-Gesellschaft. Auch andere große Forschungseinrichtungen wie die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren oder die Leibnitz-Gemeinschaft bieten Promotionsprogramme an.
Promotionsprogramme an Graduiertenschulen gibt es aber nicht nur in den klassischen universitären Fächern. Explizit künstlerische Forschungsabsichten werden beispielsweise an der Graduiertenschule der Universität der Künste Berlin (UdK) gefördert und mit einem zweijährigen Stipendienprogramm begleitet. Voraussetzung für ein solches sind eine dreijährige Berufserfahrung im künstlerischen Umfeld und eine aussagekräftige Bewerbung mit entsprechenden Referenzen. Nähere Informationen finden alle Interessierten auf der Webseite der UdK.
Schon gewusst?
Sie sind noch unschlüssig, ob Sie promovieren sollten? Finden Sie es heraus! Als registrierte:r Nutzer:in können Sie kostenlos den academics-Promotionstest machen, den wir gemeinsam mit dem Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg entwickelt haben.
Voraussetzungen und Bewerbung für die Promotion an einer Graduiertenschule
Das Bewerbungsverfahren ist je nach Standort und Einrichtung verschieden. Grundsätzlich wird bei der Kandidatenwahl darauf geachtet, dass der:die Bewerber:in während ihres Studiums bereits über den Tellerrand hinaus geschaut und sich mit wenigstens einer weiteren Fachrichtung beschäftigt hat. Zudem ist die Beherrschung der englischen Sprache Pflicht: Die Veranstaltungen an Graduiertenschulen werden in der Regel in Englisch abgehalten.
Nach der ersten Bewerbungsrunde steht häufig ein Assessment-Center auf dem Plan. Hier müssen die Bewerber:innen Vorträge halten und zeigen, dass sie ins Team passen. Einige Graduiertenschulen bieten für ausländische Bewerber:innen auch Vorstellungsgespräche über Videokonferenzen an.
Ablauf und Dauer
Ist die Aufnahme an einer Graduiertenschule geschafft, können sich die Doktorand:innen in der Regel auf eine gute Betreuung freuen. Zugleich werden sie aber auch gefordert – beispielsweise müssen die jungen Wissenschaftler:innen regelmäßig Zwischenergebnisse ihrer Arbeit präsentieren. Durch dieses fokussierte und strukturierte Vorgehen werden die Promovierenden dabei unterstützt, ihre Promotion im Schnitt bereits nach 51 Monaten abzuschließen. Weitere Infos: Graduiertenschulen im Porträt.
An einem von der DFG geförderten Graduiertenkolleg promovieren
Die Professorin fliegt gerade aus Tokio ein, der Professor startet nächste Woche eine Forschungsreise in Richtung Himalaya: An vielen Graduiertenkollegs in Deutschland geht es international zu – auch für Doktorand:innen. Die meisten Graduiertenkollegs in Deutschland werden von der DFG finanziert. Aktuell fördert die DFG insgesamt ca. 220 Graduiertenkollegs in Deutschland, davon ca. 30 Internationale (IGK).
All diese Einrichtungen bieten den Doktorand:innen ein international geprägtes Umfeld in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Life Sciences, Sozial- und Geisteswissenschaften; die Forschungsthemen sind eng gesteckt. Anders als in Graduiertenschulen sind die Gruppen an den Kollegs mit zehn bis zwölf Doktorand:innen überschaubar. Dadurch ist eine persönliche und intensive Betreuung möglich – beziehungsweise sogar Pflicht: „Mehrfachbetreuung ist an Graduiertenkollegs verpflichtend, und die Betreuungssituation wird bei der Antragstellung begutachtet. Ist sie nicht angemessen angelegt, dann wird dieses Kolleg auch nicht gefördert“, erklärt Dr. Armin Krawisch, Leiter der Gruppe Graduiertenkollegs und Karriereförderung bei der DFG.
Ein weiterer Pluspunkt laut Krawisch: die gesicherte Finanzierung der Promotion. „Wenn die DFG ein Kolleg bewilligt, dann gibt es bei einer Neueinrichtung für fünf Jahre Geld. Das bedeutet: Wer eine Doktorandenstelle an einem Graduiertenkolleg hat, kann sicher sein, dass die Finanzierung der Promotion für bis zu vier Jahre steht. Das ist anderswo nicht der Fall, Stipendien sind oft schlechter dotiert und schließen keine Sozialversicherung ein oder man hat in Projekten häufig eine geringere Finanzierungsdauer.“
Als weiteren Vorteil einer strukturierten Promotion an einem DFG-finanzierten Graduiertenkolleg nennt Krawisch die umfassenden Qualifizierungsangebote – zum einen fachlich-wissenschaftliche geprägte Veranstaltungen wie beispielsweise zu Scientific Projecting, zum anderen aber auch überfachliche, in denen Soft Skills geschult werden.
„Double-Degree“-Promotion an Internationalen Graduiertenkollegs (IGK)
Internationale Kollegs zeichnen sich über das Angebot nationaler Kollegs hinaus durch eine feste Kooperation mit mindestens einer Partnereinrichtung im Ausland aus. Die Promotion wird hier von Professor:innen aus Deutschland und aus dem jeweiligen Partnerland betreut. Vielerorts wird an den Internationalen Graduiertenkollegs auch an der Einführung einer offiziellen „Double-Degree“-Promotion gearbeitet – eine Promotion, die offiziell an zwei Standorten und damit auch binational abgeschlossen werden kann.
Darüber hinaus können die Doktorand:innen mit finanzieller Unterstützung der DFG die ausländische Partnereinrichtung besuchen und dort forschen. Bewerber:innen fsollten neben einem sehr guten Universitätsabschluss vor allem Freude an interkultureller und interdisziplinärer Arbeit mitbringen und eine Affinität für das spezielle Forschungsgebiet des Kollegs haben.
Englisch als Arbeitssprache
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist außerdem die Beherrschung der englischen Sprache, der gebräuchlichen Arbeitssprache in den Kollegs. Promovierende in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Kollegs sollten darüber hinaus auch die Landessprachen lernen, in und zu denen sie forschen. Wer die Anforderungen erfüllt, kann sich mit Anschreiben, Lebenslauf, Motivationsschreiben und Forschungsexposé bei den Kollegs bewerben. Diejenigen, die mit ihrer schriftlichen Bewerbung überzeugen können, werden zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.
Dr. Armin Krawisch, Leiter der Gruppe Graduiertenkollegs und Karriereförderung bei der DFG
Promotionsstudiengänge an Universitäten
Wer das klassische Studium an einer Universität liebt, wird sich auch in einem universitären Promotionsstudiengang wohlfühlen. Denn dort setzen sich die altbekannten Strukturen des Studiums fort: Die Doktorand:innen erhalten einen meist verpflichtenden Stundenplan, der mit Seminaren, Kursen und Diskussionsrunden gespickt ist. Ein Jahrgang besteht für gewöhnlich aus mehreren Dutzend Promovierenden.
Promotionsstudiengang: Möglichkeiten zum berufsbegleitenden Promovieren
Häufig erhalten die Doktorand:innen für jeden im Promotionsstudiengang erfolgreich belegten Kurs Credit Points gemäß europäischem ECTS-Standard. Für den Abschluss der Promotion muss neben dem Verfassen der Dissertation eine bestimmte Anzahl solcher Credit Points erreicht sein. Anders als im Bachelor- und Masterstudium sind die zu belegenden Lehrveranstaltungen meist Blockveranstaltungen, die nicht wöchentlich, sondern gebündelt an festgelegten, aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr stattfinden.
Das erlaubt den Doktorand:innen, die Promotion auch berufsbegleitend zu absolvieren. „Viele unserer Doktoranden stehen schon mitten im Berufsleben und promovieren darüber hinaus an unserem Institut. Dies ist möglich, da sie einen flexiblen Stundenplan vorliegen haben, nach dem sie ihre Arbeitszeiten ausrichten können“, sagt die Fachstudienberaterin für den Promotionsstudiengang Geographie an der Universität Würzburg, Professorin Barbara Sponholz. Diese Kombination aus Beruf und Studium ist aus finanzieller Sicht sehr hilfreich für Doktorand:innen eines Promotionsstudiengangs, dessen Finanzierung eigenständig geleistet werden muss.
Neben der Selbstfinanzierung über eine Berufstätigkeit besteht die Möglichkeit, ein Promotionsstipendium zu beantragen oder sich auf eine der wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen zu bewerben, die unabhängig vom Promotionsstudiengang von den Instituten ausgeschrieben werden.
Promotionskolleg an der Uni: Voraussetzungen und Bewerbung
Wer sich für ein Promotionsstudium interessiert, sollte sich zunächst einen Gesamtüberblick über das vielfältige Angebot verschaffen und sich dann im Internet informieren. Auf den Webseiten der Universitäten und Institute finden sich Informationen zu den speziellen Zugangsvoraussetzungen und individuellen Bewerbungsverfahren.
Generell gilt: Bewerber:innen sollten ihr Studium in der jeweiligen Fachrichtung mit mindestens einem Notendurchschnitt von 2,0 abgeschlossen haben. „Wer unter diesem Schnitt liegt, hat es schwer, zur Promotion angenommen zu werden. Wir versuchen, die besten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für unser Institut zu gewinnen“, so Prof. Sponholz. Für all diejenigen, die lediglich einen Bachelorabschluss besitzen oder sich in Fach oder Sprache nicht fit genug fühlen, gibt es die Möglichkeiten, an einer Universität entsprechende Vorbereitungsjahre zu absolvieren.
Ablauf und Dauer
Die Dauer eines strukturierten Promotionsstudiums variiert, liegt aber im Schnitt bei vier Jahren. Neben dem klaren Curriculum bieten die Promotionsstudiengänge zudem eine sehr gute Betreuung für Doktorand:innen. Jedem von ihnen wird ein:e Betreuer:in zur Seite gestellt, der bei Fragen rund um die Promotion Ansprechpartner:in ist. Meist ist der oder die Betreuende gleichzeitig auch der Doktorvater bzw. die Doktormutter.
Viele Promotionsstudiengänge werden in der Regel in Deutsch oder Englisch abgehalten. Ausländische Doktorand:innen sollten sich daher im Vorfeld über die Arbeitssprache ihres Promotionsstudienganges informieren, um gegebenenfalls einen Sprachkurs zu belegen.