Mathematikstudium Berufe
Was macht ein Mathematiker oder eine Mathematikerin – und wo arbeiten sie?
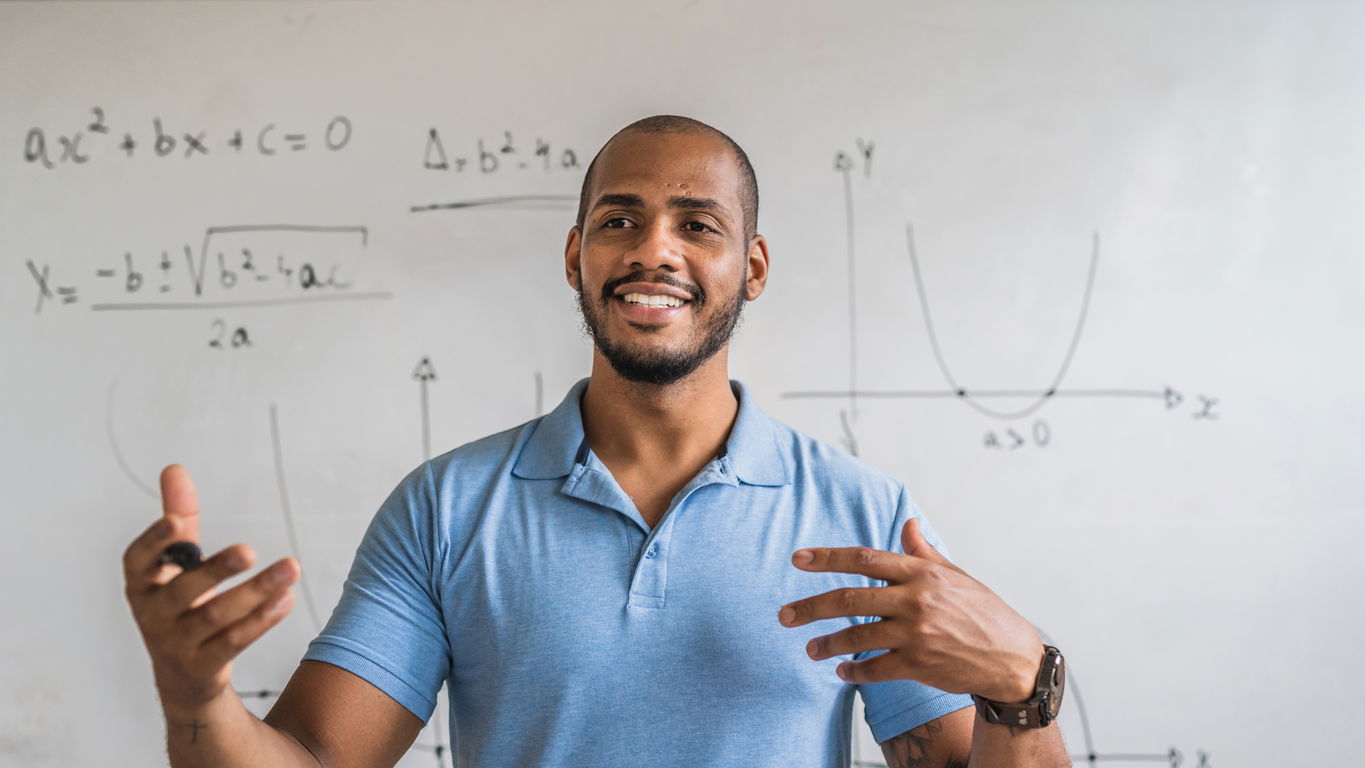
Es gibt viele Karriereperspektiven in der Mathematik © Igor Alecsander / iStock
Auf Mathematik-Absolventinnen und -Absolventen wartet ein breites Spektrum an Jobs. Die Einstiegsvoraussetzungen und Karriereperspektiven sind sehr verschieden.
Aktualisiert: 08.12.2023
Teilgebiete der Mathematik
Die Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften und befasst sich ihrem griechischen Wortursprung nach mit der „Kunst des Lernens“. Wer Mathematik studiert, beschäftigt sich – um es etwas konkreter zu machen – mit grundlegenden mathematischen Fragestellungen zu Zahlen, Formen, Gleichungen, aber auch Teilbarkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Die wichtigsten Teilgebiete der Mathematik:
- Arithmetik
- Geometrie
- Algebra
- Zahlentheorie
- Wahrscheinlichkeitstheorie
- Analysis
- Funktionentheorie
- Differentialgeometrie
- Mengenlehre
- Statistik.
Mathematiker:innen – also Menschen, die sich mit der Anwendung und Entwicklung der Mathematik beschäftigen – erwerben ihr Wissen in einem Mathematikstudium. Neben dem reinen Mathematikstudium gibt es inzwischen auch eine Vielzahl interdisziplinärer Studiengänge, wie zum Beispiel Wirtschafts-, Techno- oder Biomathematik.
Das Mathematikstudium
Das Bachelorstudium dauert üblicherweise sechs bis sieben Semester und schließt mit dem Bachelor ab, der anschließend um den Masterabschluss und eine Promotion erweitert werden kann. Die meisten Mathematik-Studiengänge sind zulassungsfrei, einen Numerus Clausus gibt es lediglich bei einigen Lehramtsstudiengängen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gab es im Wintersemester 2022/2023 insgesamt 64.780 Mathematikstudierende.
Berufe für Mathematiker und Mathematikerinnen
Mathematiker-Jobs gibt es in vielen Branchen, entsprechend breit ist für sie das Spektrum bei der Berufswahl. Die Aufgaben und Herausforderungen variieren je nach Einsatzgebiet. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Berufsfelder, die damit verbundenen Aufgaben und Berufsmöglichkeiten.
Berufsfelder und Aufgaben für Mathematiker und Mathematikerinnen:
| Berufsfeld | Aufgaben (Beispiele) | Berufsmöglichkeiten (beispielhaft) |
|---|---|---|
|
Forschung und Lehre an Schulen, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen |
Vermittlung von Lehrinhalten, (Grundlagen-)Forschung |
Mathematiklehrer:in an Schulen, Dozent:in an Hochschulen, Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in, Gruppenleiter:in, Professor:in an Hochschulen oder staatlichen Forschungseinrichtungen |
|
Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in privaten Forschungseinrichtungen |
Produktforschung und -entwicklung, Prozessoptimierung, Nachhaltigkeitsforschung |
Marktanalyst:in, Mitarbeiter:in in der Produktentwicklung, Data Manager:in |
|
Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst |
Studien erarbeiten und begleiten, Diagnoseverfahren entwickeln, physikalische Phänomene untersuchen |
Statistiker:in, Data Manager:in, Biostatiker:in |
|
Finanz-, Versicherungs- und Rechnungswesen |
Analysen erstellen, Risiken bewerten, Beratungsfunktionen, Kostenstrukturen optimieren, neue Absatzmärkte prüfen und erschließen |
Data Analyst, Marketingspezialist:in, Produktentwickler, Controller:in, Versicherungsmathematiker:in/Aktuar:in, Wirtschaftsprüfer:in |
|
IT- und Softwareindustrie, Elektrotechnik |
Programme entwerfen, Netzwerke planen, Hardware entwickeln, Daten erheben und weiter bearbeiten |
Projektmanager:in, Data Scientist, Softwarentwickler:in |
|
Unternehmensberatung |
beratende Tätigkeiten, Entwicklung von Strategien und Geschäftsmodellen, Unterstützung des Vertriebs, Risikomanagement |
Consultant, Data Scientist, Analyst:in, Projektmanager:in |
|
Markt- und Meinungsforschung |
Erarbeitung von Statistiken, Diagrammen, Analysen und Prognosen; beratende Tätigkeiten |
Research Analyst, Market Research Consultant, Data Analyst |
|
Logistik |
Prozess- und Artikelanalysen, Bedarfs- und Produktionsplanung, Lagerhaltung, Tourenplanung |
Supply Chain Manager:in/Analyst:in/Planner:in, Data Scientist/Analyst:in |
Die Auflistung zeigt, wie vielseitig Mathematiker:innen dank ihrer generalistischen, analytischen Fähigkeiten einsetzbar sind und in wie vielen Bereichen sie grundsätzlich gesucht werden. Wer den Weg in die Mathematik einschlägt, sollte jedoch berücksichtigen, dass Arbeitgeber im Zuge der Digitalisierung verstärkt Mitarbeitende suchen, die möglichst generalistisch eingesetzt werden können und deren mathematisches Wissen nicht zu stark auf einen bestimmten Aspekt fokussiert ist.
Arbeiten in der Mathematik: Diese Kompetenzen sind wichtig
Wer Freude an Zahlen hat, in der Lage ist, abstrakt und analytisch zu denken, gern tief in komplexe Problemstellungen einsteigt und sie mit Geduld und Logik löst, erfüllt die wichtigsten Voraussetzungen, um ein Mathematikstudium erfolgreich abzuschließen.
Im anschließenden Berufsleben sind diese Kompetenzen ebenfalls essenziell, egal ob man an der (Hoch-)Schule bleibt und sich der Wissenschaft und Lehre widmet oder den Weg in die Wirtschaft einschlägt und in der Entwicklung, Beratung oder im Vertrieb arbeitet.
Fest steht: Im zukünftigen Job warten nicht nur Zahlen, sondern auch die Herausforderung, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und darzustellen, beispielsweise gegenüber Kolleg:innen aus anderen Abteilungen oder Kunden.
Über diese Kompetenzen sollten Mathematiker:innen verfügen:
- Affinität zu Zahlen
- Keine Angst vor komplexen Themen
- Problemlöser-Mentalität
- Abstraktes, logisches Denken
- Ehrgeiz und Geduld
- Sorgfältige Arbeitsweise
- Die Fähigkeit, Komplexes einfach darstellen
- Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit.
Karriereperspektiven und Gehalt für Mathematiker
Grundsätzlich sind Mathematiker:innen wie alle Absolvent:innen in den MINT-Fächern sehr gefragt, die Berufsaussichten sind exzellent. Das wirkt sich gleich doppelt positiv aus: Die Arbeitslosenquote unter Mathematikabsolvent:innen ist niedrig und das Durchschnittsgehalt bei Mathematikern und Mathematikerinnen fällt mit rund 72.000 Euro brutto pro Jahr (Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Medianwert) überdurchschnittlich hoch aus. Was ein Mathematiker oder eine Mathematikerin verdient, hängt – neben dem Geschlecht – von weiteren Faktoren ab:
- Berufserfahrung
- Branche
- Unternehmensgröße
- Studienabschluss (Diplom, Bachelor, Master, Promotion).
Sehr gefragt sind Kombi-Kompetenzen, die es ermöglichen, Mathematiker:innen vielseitig einzusetzen. Wer eher monothematisch ausgerichtet ist, hat in der Regel schlechtere Berufsaussichten als ein Allrounder. Mit einer strategisch gut geplanten Mischung aus Schwerpunkten und Nebenfächern – etwa Informatik, Physik, BWL oder Elektrotechnik – sind die Chancen auf einen attraktiven Job sehr hoch. Sieht die berufliche Planung früher oder später eine Führungsposition vor, ist ein anschließender Masterabschluss oder sogar eine Promotion empfehlenswert.
Besonders hoch ist nach Angaben der Deutschen Mathematiker-Vereinigung derzeit zum einen die Nachfrage nach Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsberufs Mathematik – auch der Quereinstieg ist möglich. Zum anderen werden Mathematiker:innen auch für die Auswertung von Big Data händeringend gesucht, etwa in den Forschungsbereichen der Lebenswissenschaften, der Physik, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Mit Praktika und Promotion im Lebenslauf punkten
Wie für viele andere Berufe und Fächer, so gilt auch für Mathematiker:innen: Berufserfahrung wertet den Lebenslauf auf und kann sich positiv auf die Karriereperspektiven und auch auf das Gehalt auswirken. Arbeitgeber sehen es gerne, wenn Bewerbungen praktische Erfahrung in Form von Praktika oder Werkstudententätigkeit belegen und theoretisches Wissen während des Studiums schon einmal praktisch angewandt wurde.
Praxiserfahrung lohnt sich für Studierende im späteren Arbeitsleben besonders dann, wenn sie bereits an der Uni wissen, welchen Beruf sie einmal ergreifen sollen und ein entsprechendes Praktikum oder einen Werkstudentenjob vorweisen können. An manchen Universitäten und Fachhochschulen bzw. HAWs sind Praxisphasen obligatorisch.
Neben Berufserfahrung können sich auch Auslandserfahrung und Sprachkenntnisse sowie gute Programmierkenntnisse bei der Jobsuche bezahlt machen. Wer als Mathematiker:in (beziehungsweise allgemein Naturwissenschaftler:in) dann noch eine Promotion vorweisen kann, hat am Arbeitsmarkt beste Chancen. Ein Doktortitel kann sich bereits beim Berufseinstieg als zusätzlicher Gehaltsbooster auswirken und im weiteren Karriereverlauf ein sechsstelliges Gehalt einbringen.







