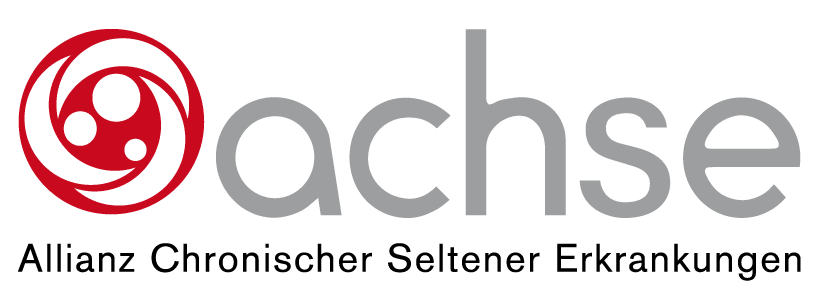Vereinbarkeit Familie und Forschung
Forschung und Familie: Karriere mit Kind

Wie gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Forschung? © Arsenii Palivoda / iStock
Die Wissenschaftskarriere zu managen, ist ohnehin schon anspruchsvoll. Wenn Kinder hinzukommen, gerät die Karriereplanung zum Drahtseilakt. Wie die Vereinbarkeit von Familie und Forschung dennoch gelingen kann.
Aktualisiert: 30.01.2025
Akademische Laufbahn und Kinder – geht das zusammen?
Forschung und Familie unter einen Hut zu kriegen, ist für viele Wissenschaftler:innen ein Drahtseilakt. Für viele Nachwuchsforschende fällt die wissenschaftliche Qualifizierung mit der Familiengründungsphase zusammen, doch ist die Betreuung von kleinen Kindern äußerst zeitintensiv. Gerade in den ersten Lebensjahren werden Kinder häufig krank, im schulfähigen Alter ergeben sich neue Herausforderungen wie die Organisation der Ferienbetreuung. Noch schwieriger ist die Situation für Alleinerziehende.
Ein zusätzliches Problem: Ein Großteil der Nachwuchswissenschaftler:innen arbeiten mit befristeten Arbeitsverträgen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Damit stellt sich auch die Frage, ob und unter welchen Bedingungen sie nach der Geburt ihres Kindes an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können.
Gerade im wissenschaftlichen Betrieb sind häufige Standortwechsel oder weite Strecken zur Arbeitsstätte nicht unüblich – auch das nimmt Wissenschaftler:innen die Sicherheit, sich ausreichend um ihren Nachwuchs kümmern zu können oder langfristig vorauszuplanen. Ein halbes Jahr Forschungsaufenthalt im Ausland? Mit einem Kleinkind eine riesige Herausforderung.
Ein relativ geringes Gehalt, insbesondere während der Promotionsphase, stellt junge Akademiker:innen zudem vor weitere Hürden, wenn sie sich entschließen, eine Familie zu gründen. Oft reicht das Gehalt gerade so, um über die Runden zu kommen. Dass viele junge Nachwuchsforschende Abstand von der Familienplanung nehmen, ist somit verständlich. Viele Wissenschaftler:innen mit Kindern machen aber auch Abstriche im Beruf und fallen so oftmals von der Karriereleiter.
Beides drängt die Frage auf: Ist es überhaupt möglich, Familie und Forschung zu vereinbaren, ohne auf das eine oder das andere gänzlich verzichten zu müssen? Und was tut der Gesetzgeber, um junge Eltern in der Wissenschaft zu unterstützen?
Mutterschutz und Elternzeit: Wann zurück an die Uni?
Auch für werdende Mütter im akademischen Umfeld gelten die Mutterschutzregelungen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG). Das bedeutet: In den letzten sechs Wochen vor einer Geburt sind Schwangere von ihrer beruflichen Tätigkeit freizustellen – es sei denn, sie wollen ausdrücklich weiterarbeiten.
Nach der Geburt eines Kindes jedoch herrscht ein achtwöchiges Beschäftigungsverbot. Oftmals zwingen befristete Verträge oder Karrieredruck junge Mütter schneller wieder zurück an die Uni oder das Labor. Doch dann stehen junge Familien vor der Herausforderung, berufliche Tätigkeiten und Kinderbetreuung miteinander zu vereinbaren.
Für die Dauer der Elternzeit ist auch entscheidend, in welchem Fachbereich die frischgebackene Mutter arbeitet: Für Geisteswissenschaftlerinnen ist ein Wiedereinstieg schneller möglich als beispielsweise für Naturwissenschaftlerinnen oder Ärztinnen. Denn diese könnten beruflich in Kontakt mit giftigen Substanzen, schädlicher Strahlung oder Gasen kommen. Solange die Gesundheit von Mutter und Kind jedoch nicht in Gefahr ist, steht einer frühzeitigen Rückkehr in den Job nichts entgegen.
Elternzeit frühzeitig planen
Am besten machen sich werdende Eltern, die in der Wissenschaft tätig sind, schon vor der Geburt des Kindes Gedanken darüber, wie lange sie in Elternzeit verbleiben wollen und wie das Kind betreut werden kann, wenn diese endet. Vor allem sollten sich junge Eltern frühzeitig erkundigen, welche Möglichkeiten es beim jeweiligen Arbeitgeber gibt, Arbeitszeiten so zu gestalten, dass sie mit der Kinderbetreuung zusammenpasst. Teilzeitregelungen während der Elternzeit kann der Arbeitgeber beispielsweise nur dann ablehnen, wenn dringliche dienstliche Gründe dagegensprechen.
Wenn Wissenschaftler:innen noch während der Elternzeit beginnen, teilweise wieder in den Job einzusteigen, sollten sie sich Gedanken darüber machen, inwiefern sie für ihre Vorgesetzten und Kolleg:innen erreichbar sein und welche Tätigkeiten sie übernehmen wollen. Und wenn die Elternzeit länger dauern sollte, kann es nicht schaden, den Forschungsstand im jeweiligen Fachgebiet weiter zu verfolgen.
Elternzeit mit Professur vereinbar?
Ob werdende Mutter oder werdender Vater: Wer die wissenschaftliche Karriereleiter ganz nach oben geklettert ist, fragt sich, ob und wie Elternzeit mit dem straffen Arbeitspensum einer Professur zu vereinbaren ist.
Zunächst einmal gilt: Aus rechtlicher Sicht darf ein Berufungsverfahren nicht aufgrund einer Schwangerschaft eingestellt werden. Allerdings treten dienstrechtliche Schutzvorschriften erst dann ein, wenn der potenzielle Arbeitgeber über die Schwangerschaft informiert wurde. Auch können mögliche Teilzeitlösungen während der Elternzeit oder ein späteres Eintrittsdatum aufgrund von Mutterschutz erst dann mit dem Arbeitgeber ausgehandelt werden, wenn dieser im Bilde ist.
Zwar ist es rechtlich gesehen möglich, zunächst die generellen Rahmenbedingungen einer Professur abzustecken und eine Schwangerschaft oder geplante Elternzeit erst im Nachhinein anzugeben, für ein gutes Arbeitsverhältnis empfiehlt es sich jedoch, von Anfang an mit offenen Karten zu spielen. Für werdende Eltern im Berufungsverfahren kann es hilfreich sein, sich noch vor den Berufungsverhandlungen mit dem oder der Gleichstellungsbeauftragten des Arbeitgebers in Verbindung zu setzen.
Mutterschutz im laufenden Semester
Insbesondere für schwangere Professorinnen gilt: Auch sie unterliegen dem Mutterschutzgesetz und somit den entsprechenden Regelungen wie beispielsweise dem Beschäftigungsverbot nach der Geburt. Ist abzusehen, dass der Mutterschutz im laufenden Semester eintreten wird, so kann der Lehrumfang im Vorhinein reduziert werden.
Bei einem Eintritt in den Mutterschutz nach der Hälfte des Semesters würde der Lehrumfang somit von 18 auf neun Semesterwochenstunden verringert werden. In jedem Fall sollten schwangere Lehrstuhlinhaberinnen so schnell wie möglich Kontakt zu ihrem zuständigen Dekanat aufnehmen. In der Regel können Mutterschafts- oder Elternzeiten von Professor:innen durch die Vergabe von Lehraufträgen ausgeglichen werden.
WissZeitVG: Die „familienpolitische Komponente“
Dem Gesetzgeber sind die Probleme, die sich aus einer Doppelbelastung aufgrund wissenschaftlicher Karriere und Familienplanung ergeben können, seit Jahren bewusst. So wurde im 2007 verabschiedeten WissZeitVG eine Erleichterung für Eltern in Form der sogenannten „familienpolitischen Komponente“ geschaffen.
Die gesetzlich festgelegte Sechs-Jahres-Frist, die für wissenschaftliche Anstellungen einmal während der Promotion und einmal in der Postdoc-Phase gilt, verlängert sich laut WissZeitVG um zwei Jahre pro Kind. Zudem werden Mutterschutz und Elternzeit nicht auf die Höchstbeschäftigungsdauer angerechnet.
Tritt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin beispielsweise nach zwei Jahren befristeter Tätigkeit in den Mutterschutz und die anschließende Elternzeit ein, so hat sie bei der Rückkehr in den Job noch vier Jahre „übrig“. Durch die Regelungen des WissZeitVG kommen für die Erziehung des Kindes noch weitere zwei Jahre hinzu. Bei einem zweiten oder dritten Kind kommen noch einmal zwei beziehungsweise vier Jahre hinzu. Sind beide Elternteile in der Wissenschaft tätig, erhält auch der Vater jeweils zwei Jahre pro Kind mehr.
Schon gewusst?
Hochschulen haben die Möglichkeit, sich über das „audit familiengerechte hochschule“ als besonders familienfreundlich zertifizieren zu lassen. Eine Übersicht der aktuell zertifizierten Unternehmen, Institutionen und Hochschulen finden Sie hier: www.beruf-und-familie.de
Befristete Arbeitsverträge: Wird bei Mutterschutz und Elternzeit verlängert?
Auch wenn Mutterschutz und Elternzeit nicht auf die Höchstdauer der wissenschaftlichen Anstellungsfrist nach dem WissZeitVG abgezogen werden, heißt dies nicht, dass ein befristeter Vertrag auch automatisch verlängert wird. Prinzipiell werden befristete Verträge um Mutterschutz- und Elternzeitdauer verlängert – doch gilt das auch für Verträge in Wissenschaft und Forschung? Grundsätzlich ja. Werdende Mutter und Vater können eine Verlängerung ihres befristeten Arbeitsvertrags für die Dauer der gesetzlichen Mutterschutzzeit und der Elternzeit beantragen.
Entscheiden sich Eltern während der Elternzeit für ein Teilzeitmodell mit 50-prozentiger Arbeitszeit, ist eine Verlängerung um mindestens ein halbes Jahr möglich. Dies gilt in der Regel auch für Akademiker:innen, die einer Befristung durch das WissZeitVG unterliegen. Die familienpolitische Komponente schafft eine Verlängerungsoption, der jedoch beide Vertragsparteien zustimmen müssen – automatisch verlängert sich der Vertrag also nicht.
Anders sieht es hingegen bei Drittmittelprojekten aus. Wollen junge Mütter oder Väter aus der Elternzeit zurück in einen durch Drittmittel finanzierten Vertrag, könnte die Frist und damit die Finanzierung bereits ausgelaufen sein.
Forschungsförderung und -programme für Eltern
Auch bei der Forschungsförderung wurden forschenden Müttern und Vätern Zugeständnisse gemacht. So enthielt bereits das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU keine Altersgrenzen und berücksichtigte Eltern- und Mutterschutzzeiten mehr.
Im Zuge ihrer „Forschungsorientierten Gleichstellungs- und Diversitätsstandards“ wartete die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 2008 mit einem Instrumentenkasten zur Vereinbarkeit von Forschung und Familie auf. In diesem Instrumentenkasten fanden sich bereits konkrete Maßnahmen von Einrichtungen wie etwa Vaterberatungsstellen und Reisekostenzuschüsse für Nachwuchswissenschaftler:innen, die ihr Kind mit auf eine Tagung nehmen müssen.
Im Zuge des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes StaRQ (Standards, Richtlinien und Qualitätssicherung für Maßnahmen zur Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft) wurde vom Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CWES) ein Onlineportal ins Leben gerufen, das Recherchetools und Informationen rund um Gleichstellungsmaßnahmen bereitstellt. Zusammen mit dem Instrumentenkasten der DFG entstand so die Datenbank INKA, in der Forschende mit Kind beispielsweise nach konkreten Hilfsangeboten ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung suchen können.
Auch in den Chefetagen von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen selbst setzte unlängst ein Umdenken ein. Arbeitsverträge enthalten immer öfter flexible Arbeitszeitmodelle, und immer mehr Hochschulen und Forschungseinrichtungen bieten eigene Betreuungsmöglichkeiten inklusive Notfallbetreuung an.
An den Einrichtungen sind es in der Regel die Gleichstellungsbeauftragten, die ein umfangreiches Beratungsangebot zum Thema Vereinbarkeit von Forschung und Familie bereithalten. Am besten lassen sich werdende Eltern frühzeitig beraten, welche Rechte und Möglichkeiten sie speziell an ihrer Einrichtung haben.
Finanzielle Unterstützung: Elterngeld und Co.
Als finanzielle Unterstützung für die Elternzeit können Angestellte, Beamt:innen und auch Selbstständige das Elterngeld beantragen. Dieses berechnet sich nach dem durchschnittlichen Einkommen der vergangenen zwölf Monate und wird für mindestens zwölf Monate gezahlt. Bis zu 14 Monate sind möglich, wenn beide Elternteile für je mindestens zwei Monate in Elternzeit gehen oder ein Elternteil alleinerziehend ist. Mit dem ElterngeldPlus haben Eltern zusätzlich die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum Elterngeld zu beziehen und zugleich in Teilzeit zu arbeiten, während beispielsweise der Partner die Betreuung übernimmt. Auch Mischformen zwischen Elterngeld und ElterngeldPlus sind möglich.
Wer ein Stipendium bezieht, hat allerdings schlechte Karten beim Elterngeld. Ein Stipendium gilt nämlich nicht als Erwerbseinkommen und Geförderte erhalten beim Elterngeld grundsätzlich nur den Sockelbetrag von 300 Euro. Es lohnt sich allerdings, mit dem Stipendiengeber Kontakt aufzunehmen – viele verlängern die Laufzeit des Stipendiums um die Familienzeit.
Die Studienstiftung des deutschen Volkes etwa verlängert die Förderzeiten von frisch gebackenen Müttern und Vätern um bis zu zwölf Monate. Mütter erhalten zusätzlich drei Monate Verlängerung ihres Stipendiums aufgrund des Mutterschutzes.
Familienfreundliche Organisation von wissenschaftlicher Arbeit
Nach der Rückkehr aus der Elternzeit lässt sich die alltägliche wissenschaftliche Arbeit durchaus familienfreundlich organisieren. So können Besprechungen beispielsweise während Kita-Zeiten stattfinden und viele Aufgaben lassen sich auch vom heimischen Computer aus erledigen. Da viele Akademiker:innen keine Kinder haben, sind ihnen die erschwerten Bedingungen für Mutter und Väter oft nicht bewusst, aber sie sind sehr wohl zu Zugeständnissen bereit. Eltern sollten ihre Vorgesetzten und Kolleg:innen deshalb auf ihre spezifischen Bedürfnisse aufmerksam machen.
Das Entwickeln von Notfallszenarien für den Fall, dass das Kind krank wird und eine nicht aufschiebbare Aufgabe zu erledigen ist, kann sinnvoll sein. Das ist umso wichtiger für Alleinerziehende. Es sollte außerdem frühzeitig überlegt werden, welche Tätigkeiten und Arbeitszeitmodelle der Familiensituation entsprechen und welche sich gar nicht vereinbaren lassen. Gerade Laborarbeiten werden schnell zum Problem – die Experimente folgen einem strengen Protokoll, das eine plötzliche Erkältung eines Kindes natürlich nicht vorsieht. Vielleicht können Kolleg:innen diese Arbeiten übernehmen. Gegebenenfalls kommt der Wechsel zu einem verwandten Forschungsgebiet in Frage, in dem der Faktor Zeit eine geringere Rolle spielt.