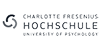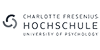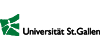Lehrauftrag an der Hochschule
Was ist ein Lehrauftrag und wie wird man Lehrbeauftragter?

Lehraufträgen werden häufig über Netzwerke und Kontakte geteilt. © jk2411 / photocase.de
Viele Hochschulabsolventen und -absolventinnen, die eine akademische Karriere anstreben, erfüllen Lehraufträge an Universitäten. Doch was ist ein Lehrauftrag, was setzt er voraus, wie wird er vergütet?
Aktualisiert: 28.10.2022
Artikelinhalt
Was ist ein Lehrauftrag an der Uni oder HAW?
Ein Lehrauftrag ist in Deutschland ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis eigener Art. Geregelt ist es in den Hochschulgesetzen der Bundesländer. Lehraufträge werden in der Regel nicht ausgeschrieben, sondern an geeignete Personen erteilt. Üblicherweise sind dafür die Dekanate oder Fakultätsräte der Hochschulen zuständig.
Ursprünglich bereicherten diese mit Lehraufträgen ihre theoretisch dominierten Veranstaltungen um praxisorientierte Inhalte. Diese vor allem nebenberuflich ausgeführte Aufgabe übernahmen anfangs anerkannte und erfahrene Fachleute aus den Bereichen Jura, Medizin oder Management, die den Studierenden in eigenen Vorlesungen von ihrem professionellen Alltag und den Anforderungen berichteten.
Seit den 1970er-Jahren decken die deutschen Hochschulen mit Lehraufträgen aber zunehmend weite Teile des Kern-Curriculums ab. Das heißt, dass Lehrbeauftragte mittlerweile Seminare, Übungen, Praktika und ähnliche Veranstaltungen eigenverantwortlich leiten, damit verbundene Prüfungen offiziell abnehmen und Gutachten erstellen. Mit all diesen Tätigkeiten beschäftigen sie sich sowohl im Grund- und Hauptstudium als auch in der Pflichtlehre. Damit übernehmen sie heute Tätigkeiten, die auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben, wissenschaftliche Mitarbeitende oder Professor:innen ausüben.
Allerdings greifen die Hochschulen dafür weniger auf praktisch orientiertes Lehrpersonal zurück, sondern mehrheitlich auf Absolvent:innen, die nach ihrem Abschluss eine Laufbahn in der Wissenschaft anstreben. Denn für eine solche Karriere müssen sie eine kontinuierliche Lehrerfahrung nachweisen.
In manchen Fächern ist der Anteil von Lehrbeauftragten an der Lehre mittlerweile überproportional hoch. Das liegt vor allem daran, dass sie im Gegensatz zu festangestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen eine geringere Vergütung bekommen. Um die Lage der Lehrbeauftragten an deutschen Hochschulen zu verbessern und Lehrkräfte zu unterstützen, stellt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf ihrer Website umfangreiches Informationsmaterial und Beratungsangebote bereit.
Lehrbeauftragter werden: Offene Stellen finden
Lehrbeauftragte sind im Tertiärbereich tätig, also an (Technischen) Universitäten, sonstigen Hochschulen und Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs). Diese vergeben ihre Stellen oft auf individuelle Weise. Manche Lehreinrichtungen schreiben ihre Vakanzen aus, andere nicht.
Meist werden Lehraufträge an Personen erteilt, die den Zuständigen im Fachbereich bekannt sind. Die Einstellung läuft also per Zuruf. Es ist daher besonders wichtig, entsprechende Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Aber auch Initiativbewerbungen können erfolgreich sein.
Wer einen Lehrauftrag wahrnehmen möchte, geht am besten mehrgleisig vor und nutzt unterschiedliche Quellen, um von Stellen zu erfahren und sich hierfür ins Gespräch zu bringen.
- Manche Universitäten und Fachhochschulen veröffentlichen Vakanzen auf ihren Homepages.
- Im Internet gibt es spezielle Portale, die bundesweit entsprechende Jobangebote sammeln und so die Suche erleichtern – zum Beispiel den Stellenmarkt von academics.de.
- Weil nicht alle Universitäten und sonstige Hochschulen ihre freien Stellen für Lehrbeauftragte öffentlich machen, kann sich die aktive, direkte Kontaktaufnahme zu den jeweiligen Personalverwaltungen oder den zuständigen Professoren der Fachbereiche lohnen.
- Besonders wichtig: Ein Lehrauftrag ist Vertrauenssache. Deshalb ziehen die Institutionen dafür vorzugsweise Personen heran, die sie bereits kennen. Bewerbende sollten also eigene Netzwerke nutzen oder erweitern beziehungsweise aufbauen.
Welche Voraussetzungen gelten für Lehrbeauftragte?
Universitäten und Hochschulen setzen Lehrbeauftragte für unterschiedliche Aufgaben ein. Dementsprechend weichen die Anforderungen je nach Fakultät und Zweck voneinander ab. So ist meistens ein abgeschlossenes Studium notwendig, manchmal – beispielsweise für fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen – mindestens eine Promotion.
Die diversen Ansprüche sowie Ausnahmen lassen kein allgemeingültiges Eignungsprofil für Lehrbeauftragte an Universitäten und Fachhochschulen zu. Zwei Eigenschaften müssen Bewerbende aber in jedem Fall mitbringen: Fachwissen und pädagogisches Talent.
Während beispielsweise im geisteswissenschaftlichen Bereich insbesondere sehr gute wissenschaftliche Fähigkeiten gefragt sind, müssen Lehrbeauftragte an Musik- und Kunsthochschulen die für das jeweilige Unterrichtsfach gefragten künstlerischen Leistungen vorweisen können, um sich für die Lehraufgaben zu qualifizieren.
Gehalt: Was verdient ein Lehrbeauftragter?
Lehraufträge werden in der Regel für die Dauer von einem Semester erteilt und am Ende bezahlt. Die Vergütung der Lehrbeauftragten bemisst sich grundsätzlich an ihren geleisteten Semesterwochenstunden à 45 Minuten. Deren Anzahl ist variabel und abhängig von der jeweiligen Universität oder Fachhochschule. Acht bis zehn Semesterwochenstunden beträgt das Lehrdeputat von Professoren und Professorinnen an Universitäten. Das wird oft als Höchstgrenze für Lehraufträge angesehen. Bei HAWs müssen Professor:innen 18 Semesterwochenstunden abhalten.
Für jede Wochenstunde gibt es ein Bruttohonorar. Dessen Höhe variiert ebenfalls von Hochschule zu Hochschule. Wie viel gezahlt wird, steht jeweils in den Lehrauftragsvergütungsverordnungen. Die Bandbreite der Vergütung für Lehraufträge reicht überwiegend von 15 bis 50 Euro pro Stunde; verbreitet sind 25 bis 30 Euro.
Lehrauftrag: Beispiele für aktuelle Vergütung pro Stunde nach Bundesland
| Bundesland | Stundenlohn für Lehrbeauftrage (SMS, 45 Minuten) |
|---|---|
|
Baden-Württemberg |
zwischen 30-45 Euro |
|
Nordrhein-Westfalen |
zwischen 24-40 Euro |
|
Niedersachsen |
zwischen 25-48 Euro |
|
Schleswig-Holstein |
zwischen 22-36 Euro |
|
Sachsen |
bis zu 32 Euro (ohne abgeschlossene Promotion) |
|
Thüringen |
mindestens 25 Euro |
Diese Stundensätze verstehen sich ausschließlich für tatsächlich gegebene Stunden. Vor- und Nachbereitung, Kosten für Unterrichtsmaterialien und ausgefallene Veranstaltungen werden nicht vergütet. Grundsätzlich zahlen Universitäten und gleichgestellte Hochschulen wie Gesamthochschulen, Medizinische oder auch Pädagogische Hochschulen mehr als Fachhochschulen.
Auch die Qualifikation und Reputation des Lehrbeauftragten spielen eine Rolle für die Höhe der Vergütung, ebenso die Art und der Stellenwert der Lehrveranstaltung. Es ist zum Beispiel ausschlaggebend, ob die lehrende Person bereits einen Hochschulabschluss hat oder nicht, und ob diese Lehraufgaben wie Professoren und Professorinnen wahrnimmt. Abhängig von ihren jeweiligen Regelungen vergeben die Hochschulen auch parallel laufende Lehraufträge an eine Person. Ebenso sind Folgebeschäftigungen über mehrere Semester hintereinander möglich.
Für nebenberufliche Lehrbeauftragte ist die vergleichsweise geringe Vergütung kein großes Problem. Schließlich haben sie mit ihrem eigentlichen Beruf bereits eine Haupteinnahmequelle. Allerdings ist laut GEW für die meisten der rund 100.000 Lehrbeauftragten in Deutschland die Lehrtätigkeit der einzige Job. Das betrifft zum Beispiel:
Kurz: Wichtig ist ein Lehrauftrag für alle Karrierestufen vor und nach einer Promotion sowie nach der Habilitation, um damit den notwendigen Kontakt zu Wissenschaft und Lehre zu halten.
Ein Lehrauftrag ist nicht sozialversicherungspflichtig oder steuerfrei
Die Vergütung eines Lehrauftrags gilt steuerrechtlich als Einkunft aus selbstständiger Arbeit. Das bedeutet, dass Lehrbeauftragte nicht als Arbeitnehmende im sozialversicherungspflichtigen Sinne gelten und demnach nicht über ihren Arbeitgeber kranken-, pflege- und arbeitslosenversichert sind. Lehrende müssen sich also während der Tätigkeit selbst um eine Einzahlung in die Renten- und Krankenkasse kümmern. Auch müssen sie selbstständig für eine Haft- und Unfallversicherung aufkommen.
Zudem ist das Honorar als Lehrbeauftragter oder Lehrbeauftragte per se nicht steuerfrei und muss in der jährlichen Einkommenssteuererklärung als Einkunft aus selbstständiger Arbeit angegeben werden. In der Regel kann der Verdienst aber als „Übungsleiterpauschale“ geltend gemacht werden – bis 2.400 Euro im Jahr sind so steuerfrei.
Vergleich: Nebenberuflicher Lehrbeauftragter und Lehrkraft für besondere Aufgaben
Möchten Bewerbende eine Lehrtätigkeit an einer Universität oder Fachhochschule aufnehmen, stehen ihnen mehrere Möglichkeiten offen. So können sie dort als Lehrbeauftragte arbeiten oder als Lehrkraft für besondere Aufgaben. Vom Titel her und inhaltlich unterscheiden sich die beiden Positionen auf den ersten Blick kaum, bei genauerem Hinsehen aber schon. Die beiden Beschäftigungsverhältnisse im Vergleich:
Lehrbeauftragter nebenberuflich
- Die Hochschule geht mit Lehrbeauftragten kein festes Beschäftigungsverhältnis ein. Sie sind weder angestellt noch verbeamtet, sondern haben den Status von freien Mitarbeitenden.
- Lehrbeauftragte sind nicht sozialversicherungspflichtig, wie oben bereits genannt. Einen Kündigungsschutz sowie Urlaubsanspruch haben sie daher nicht.
Lehrkraft für besondere Aufgaben
- Eine Lehrkraft für besondere Aufgaben besitzt den Status eines wissenschaftlichen, befristet oder unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden. Sie ist im öffentlichen Dienst zu einem Tarifgehalt angestellt, manche von ihnen sind verbeamtet.
- Sie ist über ihren Arbeitgeber sozialversichert.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist das Gehalt. Eine Lehrkraft für besondere Aufgaben bekommt zum Einstieg um die 3.600 Euro brutto im Monat (abhängig vom Bundesland). Das entspricht der Entgeltstufe 11 an einer Universität. Mit zunehmender Beschäftigungsdauer sammelt eine Lehrkraft Erfahrungsstufen an. Damit sind bis zu ca. 5.300 Euro Gehalt möglich.
Die Lehrverpflichtung einer Lehrkraft liegt zwischen zwölf und 18 Semesterwochenstunden, an Fachhochschulen/HAWs häufig darüber. Darauf umgerechnet kommt sie (in Vollzeitlehre ohne Forschungsaufgaben) jeweils auf einen Stundensatz von 80 bis 100 Euro inklusive Arbeitgeberzuschüssen für die Sozialversicherung – er liegt also deutlich über dem eines Lehrbeauftragten.
Unterschied: Lehrauftrag und Honorarvertrag
Ein Lehrauftrag und ein Honorarvertrag sind einander sehr ähnlich. Doch es gibt durchaus Unterschiede. Ein Lehrauftrag ist ein einseitiges öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis. Er wird – wie eingangs erwähnt – erteilt. Seine Modalitäten sind nicht verhandelbar.
Ein Honorarvertrag hingegen ist privater Natur und wird zwischen zwei Parteien (Hochschule und Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin) vereinbart und verhandelt. Allerdings ist diese Beschäftigungsform im tertiären Bereich eher unüblich, sondern eher in der Weiterbildung gängig.
Unterschied: Lehrbeauftragter und Dozent
Dozenten sind Personen, die eine Lehrtätigkeit an einer Bildungseinrichtung im Tertiärbereich ausüben. Die Bezeichnung Dozent oder Dozentin ist ein übergeordneter Sammelbegriff. Darunter fallen unter anderem
- Professoren und Professorinnen
- Privatdozenten und -dozentinnen
- wissenschaftliche Mitarbeitende
- Lehrbeauftragte
Damit sind Lehrbeauftragte zwar immer Dozenten, aber nicht alle Dozenten Lehrbeauftragte.