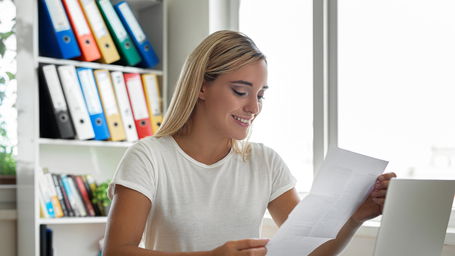Wechsel Wissenschaft Wirtschaft
Wissenschaft oder Wirtschaft: Wann lohnt der Wechsel in die Industrie?

Spätestens am Ende der Promotion stellt sich die Frage: bleibe ich in der Wissenschaft oder wechsle ich in die Wirtschaft? © BrianAJackson / istockphoto.com
Akademische Karriere oder doch lieber ein Wechsel in die Wirtschaft? Vor dieser Frage stehen viele junge Forschende nach ihrer Promotion. Ein Überblick über Vor- und Nachteile.
Aktualisiert: 11.01.2022
Wissenschaft oder Wirtschaft: Wie unterscheiden sich die Karrierewege?
Bleibe ich in der Forschung oder strebe ich eine Karriere in der freien Wirtschaft an? Vor dieser wichtigen Grundsatzentscheidung stehen Studierende am Ende ihres Masterstudiums oder nach Abschluss der Promotion. In den meisten Fällen ist es eine sehr individuelle Entscheidung, geprägt von persönlichen Vorlieben und den eigenen Plänen für die Zukunft. Sicher ist nur eins: Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile.
Zunächst steht die Entscheidung an: promovieren – ja oder nein? In einigen Fachbereichen stellt sich diese Frage kaum, hier ist der Doktortitel quasi verpflichtend, zum Beispiel in der Medizin oder in den klassischen Naturwissenschaften wie Chemie, Biologie oder Physik. In diesen Fächern gehört die Promotion nach dem Studium noch immer zum guten Ton – egal, ob man danach in einer großen Forschungseinrichtung arbeiten will, die Professur an einer Hochschule anstrebt oder doch eine Führungsposition in der industriellen Forschung reizvoll findet. Die erfolgreiche Doktorarbeitverbessert in fast jedem Falle die Karrierechancen deutlich: Sie ist der Nachweis für die intensive Beschäftigung mit einem Thema und zeigt wichtige Schlüsselkompetenzen wie Methodensicherheit, Projekterfahrung oder Organisationstalent.
In der freien Wirtschaft warten auf promovierte Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen attraktive Perspektiven. Chemikerinnen sind beispielsweise in der pharmazeutischen Forschung gefragt, Physiker mit Erfahrungen im Umgang mit großen Datenmengen können als Data Scientist arbeiten. Biologinnen verschlägt es vielleicht in den Naturschutz oder die kosmetische Forschung.
Während die Jobchancen für promovierte Absolventen und Absolventinnen in den MINT-Fächern hervorragend sind, sind gut dotierte Postdoc-Stellen in der Wissenschaft schwieriger zu bekommen – der nächste Schritt in der wissenschaftlichen Karriere hin zur Professur. Neben herausragenden Noten und relevanten, in renommierten Fachverlagen publizierten Forschungsergebnissen braucht es viel Flexibilität, Herzblut und Leiden(sbereit)schaft, um eine Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem renommierten Forschungsinstitut im In- und Ausland zu ergattern.
Selbstverständlich gibt es auch genug Fachbereiche, in denen auch ohne Promotion sehr gute Jobaussichten bestehen. Auch das beeinflusst die Entscheidung für oder gegen die Forschung. Ein gutes Beispiel dafür ist die Informatik. Heute haben auch junge Informatikerinnen und Informatiker mit Bachelorabschluss oder Quereinsteigende hervorragende Berufsaussichten. Eine Promotion strebt nur an, wer sich wirklich für die Forschung interessiert. Ähnlich sieht es auch in den Ingenieurwissenschaften aus. Ein Doktortitel wird in der Industrie höchstens noch bei Führungspositionen in Entwicklungsabteilungen ernsthaft vorausgesetzt. Berufserfahrungen und Fachwissen sind hier oft wichtiger als akademische Titel. Natürlich ist eine Promotion in der Regel aber kein Nachteil.
Arbeiten in der freien Wirtschaft: Vor- und Nachteile
Neben berufsspezifischen Gründen für und gegen das Arbeiten in der freien Wirtschaft oder Forschung gibt es auch branchenübergreifende Faktoren für die Entscheidung. Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Die akademische Laufbahn ist deutlich unsicherer. Die meisten Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende sind projektbezogen und somit auf maximal einige wenige Jahre befristet. Die Chance auf eine Professur haben nur etwa zehn Prozent derjenigen, die sich auf eine freie Stelle bewerben – und die sind schon die besten ihres Fachgebiets; attraktive Stellen im akademischen Mittelbau sind rar. Hier kann die freie Wirtschaft klar punkten.
Was spricht für eine Karriere in der freien Wirtschaft?
- Gerade Absolventinnen und Absolventen von naturwissenschaftlichen und technischen Studienfächern sind in der Wirtschaft sehr gefragt. Entsprechend hoch sind die Einstiegsgehälter, entsprechend gut die Karriereaussichten.
- Schon mit einem guten Bachelor-Abschluss und/oder entsprechender Berufserfahrungen können Ingenieure oder IT-Fachkräfte schnell Karriere machen.
- Durch den Fachkräftemangel können sich gute Absolventen – zumindest in einigen Branchen, zum Beispiel den erneuerbaren Energien oder Data Science – inzwischen quasi das Wunschunternehmen aussuchen.
- Forschung ist auch innerhalb der Industrie und Wirtschaft möglich, allerdings stärker zweckgebunden. Das macht sie nicht weniger sinnvoll, wenn es zum Beispiel um die Entwicklung von Medikamenten oder neuer nachhaltiger Technologien geht.
Es gibt aber auch Faktoren, die gegen einen Wechsel in der Wirtschaft sprechen. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Entscheidung für die Grundlagenforschung, wie sie zum Beispiel an einem Max-Planck-Institut geleistet wird. Für die grundlegende Beschäftigung mit Elementen der Chemie oder den Gesetzen der Astrophysik gibt es in der freien Wirtschaft kaum Möglichkeiten. Ähnliches gilt natürlich auch für Forschende, die sich mit Dinosauriern oder mittelalterlichem Liedgut beschäftigen. Wollen sie sich weiterhin ihrem Herzensthema widmen, führt kein Weg an einer akademischen Laufbahn vorbei. Freiheit der Forschung und Leidenschaft für sein Thema sind deshalb auch die wichtigsten Argumente für eine akademische Laufbahn, allen Widrigkeiten zum Trotz.
Was spricht für eine Karriere in der Wissenschaft?
- Die Freiheit innerhalb der Forschung ist größer. Man kann sich intensiv mit einem Forschungsthema beschäftigen, und zwar ohne Druck, ein rentables Produkt entwickeln zu müssen.
- Man kann sich mit Themen beschäftigen, die für die Wirtschaft keine Relevanz haben, zum Beispiel Mikrofossilien in der Arktis oder steinzeitliche Werkzeuge.
- Die Arbeit in der Wissenschaft ist oft sehr international, durch den Austausch mit Forschenden aus aller Welt ist man in seinem Fachgebiet am Puls der Zeit und den Entwicklungen in Wirtschaft und Industrie oftmals ein oder zwei Schritte voraus.
- Es besteht die Pflicht und damit Möglichkeit, in der Lehre Wissen an junge Studierende weiterzugeben.
Fazit: Eine Promotion schadet nie
Ein pauschaler Rat für oder gegen einen Wechsel in die Wirtschaft ist nicht möglich. Nur eins ist klar: Wer im Studium seine Leidenschaft für die Wissenschaft entdeckt, sollte sich auch mit einer Promotion beschäftigen. Die meisten Promotionsstellen an den Hochschulen und Forschungsinstituten sind auskömmlich bezahlt, Doktoranden genießen außerdem viele studentische Vorteile wie ein Semesterticket oder eine Mensacard. Auch für eine gewisse Zeit als Gastwissenschaftler ins Ausland zu gehen, kann nicht schaden – egal, welchen Weg man danach anstrebt.
Langfristig sind die Perspektiven in die freien Wirtschaft oft besser. Professuren und unbefristete Stellen im akademischen Mittelbau sind immer noch selten. Nur Forschende, die herausragende Leistungen abliefern, wirklich für die Wissenschaft brennen und bereit sind, Opfer zu bringen, haben eine reelle Chance. Wer also Wert auf Sicherheit legt, findet in der Wirtschaft vermutlich eher sein Glück.
Noch ein Tipp: Zu lange sollte man die Entscheidung für die eine oder die andere Seite aber nicht hinauszögern, sonst droht das Abstellgleis. Etwas böse ausgedrückt: Wer nach 15 Jahre intensiver Forschung an mittelhochdeutscher Literatur feststellt, dass er im Universitätsbetrieb nicht mehr weiterkommt, hat es auch schwer, in der Wirtschaft Fuß zu fassen. Es empfiehlt sich deshalb, auch mit dem Ziel einer akademischen Laufbahn rechtzeitig Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen – als Literaturwissenschaftler beispielsweise zu Verlagen – und gefragte Schlüsselkompetenzen zu erlangen: Programmierkenntnisse, Erfahrungen im Umgang mit Big Data und Künstlicher Intelligenz oder pädagogische Erfahrungen. Dann ist auch später noch ein Quereinstieg möglich.