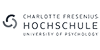Habilitationsverfahren
Voraussetzungen, Ablauf und Dauer: So gestaltet sich das Habilitationsverfahren

Wer habilitiert ist, erhält die Lehrbefähigung und meist auch die Lehrberechtigung für eine Hochschule. © fizkes / iStock
Der Weg zum Professorentitel führt häufig über die Habilitation. Erfahren Sie, was Sie dafür mitbringen müssen und was Sie beim Verfahren erwartet.
Aktualisiert: 13.11.2024
Was ist eine Habilitation?
Die Habilitation ist im deutschsprachigen Raum der klassische Weg zur Professur. Mit ihr endet die Qualifizierungsphase für die Wissenschaft: Wer sie erfolgreich meistert, hat endgültig bewiesen, dass er sein Fach thematisch, methodisch und pädagogisch beherrscht, und bekommt die Lehrbefähigung (Facultas Docendi).
Je nach Hochschule erhalten Habilitierte die Bezeichnung Privatdozent (abgekürzt PD oder Priv.-Doz.) oder dürfen ihren Doktorgrad um den Zusatz “habilitata” beziehungsweise “habilitatus” (abgekürzt “habil“) ergänzen. Sollten sie vorab nicht promoviert haben, wird ihnen unter Umständen trotzdem der akademische Grad “Dr. habil.” zugestanden – ausschlaggebend ist das jeweilige Landeshochschulgesetz oder die Habilitationsordnung der Hochschule.
Da das Professorenamt zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch für weitere Qualifikationswege geöffnet wurde – Juniorprofessoren, Nachwuchsgruppenleiter und andere Wissenschaftler mit vergleichbaren eigenständigen Leistungen haben Zugang – hat die Habilitation in vielen Fächern an Bedeutung verloren. In den Naturwissenschaften zum Beispiel zählen eher tatsächliche wissenschaftliche Leistungen und weniger die formalen Kriterien. In den Ingenieurwissenschaften besetzt man Professuren ohnehin gern mit Bewerbern aus den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen großer Unternehmen. Die Zahl der Habilitationen ist darum rückläufig.
Ein anderes Bild ergibt sich jedoch in der Humanmedizin: Dort ist die Habilitation noch immer weit verbreitet, denn sie ebnet den Weg zu leitenden Positionen in Krankenhäusern. Und auch in den Rechts- und Geisteswissenschaften wird bei der Neubesetzung von Professuren oft eine Habilitation erwartet, selbst wenn der Kandidat bereits eine Juniorprofessur bekleidet hat.
Schon gewusst?
Als registrierte:r Nutzer:in von academics erhalten Sie nicht nur passende Jobangebote per Mail, sondern profitieren darüber hinaus auch von vielen weiteren Zusatzangeboten wie beispielsweise kostenlosen Online-Seminaren. Zum Beispiel zum Thema „Die eigene Karriere in der Wissenschaft planen“.
Voraussetzungen für das Habilitationsverfahren
Die Liebe zur Wissenschaft dürfte niemandem fehlen, der über eine Habilitation nachdenkt. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Voraussetzungen fachlicher und persönlicher Natur, die Sie berücksichtigen sollten. Die fachlichen und formalen Voraussetzungen finden Sie verteilt über das Landeshochschulgesetz Ihres Bundeslandes sowie die Habilitationsordnungen Ihrer Universität und Ihrer Fachschaft. Länder und Hochschulen machen hier zum Teil sehr unterschiedliche Vorgaben. Folgendes kann, muss aber nicht von Ihnen verlangt werden:
- eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit
- pädagogische Eignung
- mehrjährige wissenschaftliche Tätigkeit in Forschung und Lehre
- das Bestehen einer Zwischenevaluierung
Eine Habilitation ist in vielen Fällen die endgültige Entscheidung für eine akademische Laufbahn, doch die Zahl der unbefristeten Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter:innen ist knapp. Um Ihre Chancen zu erhöhen, sollten Sie daher neben hervorragenden Qualifikationen auch die Begabung zum Netzwerken mitbringen. Räumliche Flexibilität ist ebenfalls ein Muss, denn nur wenigen Professor:innen ist es vergönnt, in der Nähe Ihres Wohnortes berufen zu werden. Fragen Sie sich ehrlich, ob Ihnen beides entspricht.
Ablauf des Habilitationsverfahrens
Um zur Habilitation zugelassen zu werden, müssen Sie einen Antrag beim Dekan oder bei der Dekanin stellen. Anders als bei der Dissertation erfolgt dieser Antrag hier zu einem sehr späten Zeitpunkt, nämlich erst dann, wenn der schriftliche Teil bereits abgeschlossen wurde. Vorab müssen Sie sich für Ihre Form der Habilitationsschrift entscheiden und einen Betreuer oder eine Betreuerin finden.
Monografie oder kumulative Habilitation?
Prüfen Sie zunächst, ob in Ihrem Fach eher eine Monografie oder eine kumulative Habilitation, auch Sammelhabilitation genannt, als Habilitationsschrift üblich ist. Bei letzterer können Sie Publikationsleistungen wie Zeitschriftenbeiträge oder Aufsätze, die in der wissenschaftlichen Karriere ohnehin erbracht werden müssen, anstelle der Monografie vorlegen. Sie werden dann nicht nur für eine Einzelleistung bewertet.
Einen Betreuer oder eine Betreuerin für die Habilitation finden
Obwohl – anders als bei der Promotion – eine betreuende Person für die Habilitation nicht immer vorgeschrieben ist, sollten Sie darauf für Ihr Habilitationsprojekt nicht verzichten. Der Betreuer oder die Betreuerin unterstützt Sie und wird bei der Fakultät als Ihr:e Fürsprecher:in tätig. Oft handelt es sich dabei um einen Professor oder eine Professorin des Instituts, an dem Sie tätig sind. Wollen Sie extern an einem anderen Institut habilitieren, ist auch dies möglich.
Früher war es üblich, über eine Assistentenstelle bei einem Professor oder einer Professorin zu arbeiten, der damit die Rolle des Habilitationsvaters oder der -mutter übernahm. Im Laufe dieser Zusammenarbeit wurde die Habilitationsschrift erstellt. Noch immer werden explizit Stellen mit der Möglichkeit zu habilitieren oder „zur Erlangung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen“ ausgeschrieben. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:
- Es wird die Stelle eines Akademischen Rates oder einer Akademischen Rätin geschaffen, und Sie werden als Stelleninhaber:in auf Zeit verbeamtet.
- Sie arbeiten als angestellte:r wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in bei Ihrer betreuenden Person. Die enge Zusammenarbeit hat den Vorteil, dass Sie in die Abläufe des Instituts eingebunden sind.
Auch sollten Sie darauf achten, dass zwischen Ihnen und dem Betreuer oder der Betreuerin eine Vertrauensbasis entsteht. Vielleicht können Sie vorab herausfinden, wie viele Habilitationsverfahren er oder sie schon begleitet hat und ob es bei früheren Habilitand:innen Abbrüche oder schwerwiegende Probleme gegeben hat.
Darüber hinaus sollte Ihr:e Betreuer:in in akademischen Kreisen einen guten Ruf haben – nicht zuletzt als Gütezeichen für die Habilitation. Im besten Fall hat er oder sie selbst im Bereich Ihres Habilitationsthemas gearbeitet und kann Ihnen auch inhaltliche Unterstützung bieten.
Abschluss des Habilitationsverfahrens
Sind Antrag und Habilitationsschrift eingereicht, wird ein Habilitationsausschuss eingesetzt. Dieser entscheidet über die Zulassung zur Habilitation und die Anerkennung der erbrachten Leistungen. Ihm gehören Professor:innen und ggf. auch Privatdozent:innen an. An einigen Universitäten zählen auch die Gleichstellungsbeauftragten zu den Mitgliedern des Ausschusses, der unter anderem auch Ihr Habilitationsfach benennt. Je allgemeiner die Benennung ausfällt, desto besser. Denn das Fach erscheint auf Ihrer Habilitationsurkunde und bescheinigt damit die Breite Ihrer wissenschaftlichen Fähigkeiten.
Nach der Zulassung zur Habilitation wird Ihre Habilitationsschrift begutachtet. Häufig wird hier die Expertise externer Gutachter:innen herangezogen. Nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens folgt der mündliche Teil, z. B. als Probelehrveranstaltung.
Den Abschluss des Verfahrens bildet oft das Habilitationskolloquium – ein öffentlicher Vortrag zum Habilitationsthema. Haben Sie Ihr Habilitationsprojekt erfolgreich beendet, bescheinigt Ihnen das automatisch die Lehrbefähigung. Hingegen ist die Lehrberechtigung (Venia Legendi), die Sie zum Privatdozenten oder zur Privatdozentin macht und mit der Sie Vorlesungen an Ihrer Fakultät halten dürfen, häufig extra zu beantragen.
Wie lange dauert das Habilitationsverfahren?
Die Dauer des Habilitationsverfahren kann erheblich variieren. Zum einen entscheiden Ihre persönlichen Umstände über das Vorankommen: Wie viel Arbeit haben Sie in der Vergangenheit schon erbracht, auf der Sie aufbauen können? Wie viel Zeit können Sie dem Projekt im Schnitt widmen? Das Durchschnittsalter von Habilitend:innen lag laut Statista im Jahr 2021 bei 42 Jahren.
Die Vorgaben der Länder beziehungsweise Hochschulen und Fakultäten zur Dauer des Habilitationsverfahrens sind uneinheitlich. Das Landeshochschulgesetz von Schleswig-Holstein etwa lässt den Universitäten sehr viel Freiraum und stellt nur fest: „Die Universitäten können Gelegenheit zur Habilitation geben. Das Nähere regelt der jeweilige Fachbereich durch Satzung, die der Genehmigung des Präsidiums bedarf.“ Hochschulen in Baden-Württemberg sind angehalten zu regeln, dass Habilitationen „in angemessener Zeit“ abzuschließen sind, Bayern schreibt seinen Universitäten einen Abschluss „möglichst innerhalb von vier Jahren“ vor. Liegen besondere Gründe vor – etwa Mutterschutz oder Elternzeit – können diese das Verfahren in der Regel verlängern.
Bevor Sie Ihr Habilitationsverfahren offiziell einläuten, sollten Sie also unbedingt in dem Landeshochschulgesetz Ihres Bundeslandes und auch in den Satzungen Ihrer Hochschule und Ihrer Fakultät nachschauen.