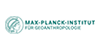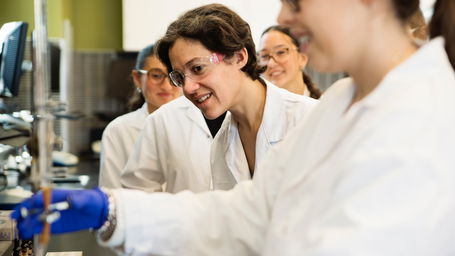Interview: Jutta Allmendinger
Uni vs. außeruniversitäre Forschung vs. Ressortforschung: Wo liegen die Unterschiede?
Wie unterscheiden sich Universitäten, außeruniversitäre Forschungsinstitute und Ressortforschungseinrichtungen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Karriereperspektiven? Wie sieht es beispielsweise jeweils mit der Forschungsfreiheit oder der Entfristungsquote aus? Die Ausnahmewissenschaftlerin Jutta Allmendinger kennt alle drei Einrichtungsarten – wir haben bei ihr nachgefragt und spannende Antworten erhalten. Auch auf die Frage, wie eine Wissenschaftskarriere gelingen kann.
Aktualisiert: 09.08.2024
Zur Person: Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger, Ph.D.
Die Soziologin Jutta Allmendinger, geboren 1956, ist eine der erfolgreichsten deutschen Wissenschaftlerinnen. Sie studierte an der Universität Mannheim sowie der University of Wisconsin und promovierte anschließend in Harvard. 1993 habilitierte sie sich an der Freien Universität Berlin.
1992 wurde Allmendinger zur Professorin für Soziologie an die Ludwig-Maximilians-Universität München berufen, von 2003 bis 2007 war sie Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Anschließend wechselte sie an das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), das sie bis heute als Präsidentin leitet. Sie ist Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin und seit 2012 Honorarprofessorin für Soziologie an der Freien Universität Berlin.
Jutta Allmendinger war und ist Mitglied zahlreicher Beiräte und Kommissionen, unter anderem ist sie seit 2017 Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT, seit Juni 2024 Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen (WKN) sowie Mitglied des Deutschen Ethikrats (ebenfalls seit 2024).
Mit ihrer beeindruckenden Karriere ist sie nicht nur ein Vorbild für Nachwuchswissenschaftlerinnen, sondern macht sich auch für Gleichstellung stark, etwa 2022 als Vorsitzende des Gender Equality Advisory Council (GEAC) der G7-Staaten. Für ihr diesbezügliches Wirken wurde sie unter anderem mit dem Soroptimist International Deutschland Förderpreises für ein Engagement zur Verbesserung der Stellung der Frau in der Gesellschaft (2012), als eine der Focus Top 100 Frauen 2020 und dem German Diversity Award in der Kategorie „Personality of the Year“ der BeyondGenderAgenda ausgezeichnet (2021).
Was sind grundlegende Unterschiede zwischen den Forschungseinrichtungsarten?
academics: Frau Professorin Allmendinger, was ist für Sie der signifikanteste Unterschied zwischen einer Ressortforschungseinrichtung, einer außeruniversitären Forschungseinrichtung und einer Hochschule?
Prof. Dr. Jutta Allmendinger: Der signifikanteste Unterschied liegt für mich darin, wer die Forschungsagenda bestimmt. In einer Ressortforschungseinrichtung ist es das entsprechende Ministerium, in den anderen außeruniversitären Einrichtungen maßgeblich die Einrichtung selbst, an Hochschulen bestimmen die Lehrstuhlinhaberinnen und -inhaber weitgehend selbst, worüber sie forschen.
Sie können an einer Universität aber wesentlich freier forschen als beispielsweise an einem Ressortforschungsinstitut, wo sie Aufträge aus der Politik bekommen? Wo ordnen Sie in dieser Beziehung die AUF ein?
Oh, mit Forschungsfreiheit hat das wenig tun. Es geht darum, inwieweit die jeweilige Forschungsagenda anschlussfähig an die der Kolleginnen und Kollegen sein muss. Ich habe alle drei Formen kennengelernt und kann das an meinem Beispiel illustrieren.
An der LMU München habe ich DFG- und andere Anträge auf den Gebieten geschrieben, die mich interessiert haben. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen musste ich mich nicht abstimmen, einen Auftrag zu einer kohärenten Fachbereichsforschung gab es nicht. Es spielte auch keine Rolle, ob die Forschung grundlagen- oder anwendungsorientiert ausgerichtet war.
Dann am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) war klar, dass sich die anwendungsorientierte Forschung auf den Gebieten zu bewegen hat, die für die Bundesagentur für Arbeit und das BMAS relevant sind.
Nun arbeite ich am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), einem Leibniz-Institut. Der Rahmen ist hier wesentlich breiter: Es geht um problemorientierte Grundlagenforschung zu Fragen gesellschaftlicher Ungleichheit. Hier gibt es das Ziel kohärenter Forschungsschwerpunkte, die bei der Besetzung von Abteilungen und bei der Ansiedelung von Gruppen berücksichtigt wird, und einer übergreifenden Zusammenarbeit.
Forschungsfreiheit und Veröffentlichungspolitik
Wenn Sie zu Forschungsergebnissen kommen, die der Politik nicht gefallen: Wird das einfach hingenommen oder gibt es da doch mal Anfragen beispielsweise andere Methoden anzuwenden, vor allem an Ressortforschungsinstituten?
Für alle Einrichtungen gilt gleichermaßen, dass ihre Forschung den Geboten guter wissenschaftlicher Praxis folgen und damit prinzipiell ergebnisoffen sein muss. Es geht bei Ihrer Frage also primär um die Veröffentlichungspolitik.
Bei den nachgeordneten Einrichtungen der Ressortforschung ist es schon üblich, dass die meisten Ergebnisse erst den Ressorts und der Selbstverwaltung vorgelegt werden. Das war auch am IAB so. Vor der breiten Veröffentlichung informierte ich meine „Auftraggeber“, sie konnten Nachfragen stellen und ihre Kommunikationsstrategie entsprechend ausrichten. Zu Beginn meiner Tätigkeit wurde nur äußerst selten mal ein Veröffentlichungstermin verschoben oder eine Veröffentlichung ganz verboten. Später erhielten wir von dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit die volle Publikationsfreiheit. Das war mir sehr wichtig: Ich wollte nicht für die Schublade forschen, unsere Ergebnisse sollten auch veröffentlicht werden. Dies ist mittlerweile bei vielen Einrichtungen der Ressortforschung Standard.
Und am WZB?
Hier steht die Veröffentlichungsfreiheit außer Frage. Was nicht heißt, ich erwähnte es schon, dass wir veröffentlichen können, was wir gerade wollen. Wissenschaftliche Standards sind die entscheidende Größe. Sie schützen uns bei allen Nachfragen und Anfeindungen.
Ein Beispiel: Vor einigen Jahren hinterfragte die AfD die Ergebnisse einer großen Studie über das Verhalten der AfD in Parlamenten. Grundlage dieser Studie war eine qualitative Erhebung und die Sichtung von Tausenden von Dokumenten. Bekanntermaßen wurde der Streit vor Gericht ausgetragen. Wir konnten nachweisen, dass wir einwandfrei gearbeitet hatten und haben gewonnen. Das war viel Arbeit, da die Rechtsanwälte der AfD die Studie bis ins letzte Detail auseinandergenommen hatten. Dennoch hatte diese Klage auch ihr Gutes. Es ist wichtig, dass die Politik Interesse zeigt, sich mit der Materie beschäftigt, Ergebnisse hinterfragt. Viel schlimmer wäre es, wenn die Forschung als solche als Fake abgetan würde.
Was ist Ressortforschung?
Ressortforschung bezeichnet seit 2007 die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Bund und Ländern. Beauftragt von den Ministerien untersuchen die Forschenden aktuelle gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Fragestellungen. Ziel der in der Regel interdisziplinär angelegten Ressortforschung ist es, fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse bereitzustellen, die für die Gestaltung und Umsetzung staatlicher und politischer Maßnahmen von entscheidender Bedeutung sind. Insgesamt gibt es in Deutschland 46 Ressortforschungseinrichtungen, davon 40 Bundeseinrichtungen und sechs außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Zu bekanntesten zählen das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Deutsche Luft- und Raumfahrtszentrum (DLR).
Entfristungsanteil: Deutlicher höher in der Ressortforschung
Gibt es zwischen den drei Arten von Einrichtungen Unterschiede hinsichtlich der Arbeitszeit, der Arbeitsmodelle oder auch Karriereperspektiven?
Die Arbeitsmodelle sind an Ressortforschungseinrichtungen und Instituten der außeruniversitären Forschung kollaborativer als an Hochschulen, es geht ja um die Bearbeitung gemeinsamer großer Forschungsthemen. Zu den Arbeitszeiten kenne ich keine vergleichende Erhebung, ich nehme aber an, dass sie an außeruniversitären Einrichtungen und an Hochschulen etwas höher liegen als in der Ressortforschung. Wie gesagt: Das ist eine reine Annahme. Sie ergibt sich aus der Antwort zum dritten Punkt Ihrer Frage, den Karriereperspektiven, insbesondere was die Möglichkeit der Entfristung an der jeweiligen Einrichtung betrifft. Unterscheidet sich die Promotionsphase noch wenig, so ist die Wahrscheinlichkeit, in der Forschung entfristet zu werden, in der Ressortforschung wesentlich höher als in den anderen beiden Organisationsformen. Am IAB arbeitete ich mit einem Entfristungsanteil von 80 Prozent.
Wie hoch ist der Entfristungsanteil an außeruniversitären Einrichtungen?
Am WZB liegt der Entfristungsanteil im Moment bei etwa 30 Prozent. In den Lebens- und Naturwissenschaften ist der Anteil infolge des Laborbetriebs etwas höher als in den Sozialwissenschaften.
Warum ist er so viel niedriger als an einer Ressortforschungseinrichtung?
In der Ressortforschung sind die Aufgaben und Themen klar definiert und ändern sich über die Jahre nur wenig. Natürlich müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer auf dem aktuellsten theoretischen und methodischen Stand sein. Das Forschungsgebiet als solches bleibt aber bestehen, es braucht keine völlige Neuorientierung.
Zwei konkrete Beispiele aus der Arbeit des WZB: Auf die Abteilung, die zur Sozialpolitik Deutschlands forschte, folgte eine Abteilung, die sich mit dem internationalen Vergleich von Armutslagen beschäftigte. Diese wiederum wurde abgelöst durch eine Abteilung, die Fragen der politischen Ökonomie im globalen Süden bearbeitet. In der Ökonomie wechselten wir von makroökonomischen Fragestellungen zu der Verhaltensökonomie.
Mit jeder Neuausrichtung der Abteilungen geht auch die Suche nach neuen Postdocs einher, also nach Expertinnen und Experten auf dem jeweiligen Gebiet. Würden wir mehr Postdocs entfristen, würde das unsere thematische Beweglichkeit einschränken und wir könnten unserem Auftrag, Forschungslücken zu identifizieren und zu füllen, nicht nachkommen. Umso wichtiger ist uns die solide, umfassende und hochwertige Förderung der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. In das career placement stecken wir gerne viel Zeit. Vor dem Vorsingen an Universitäten hören wir uns Probevorträge an, Anträge für ERC-Grants und andere große Drittmittelprojekte werden in der Leitungsebene diskutiert, all das finde ich selbstverständlich, aber auch toll. Ein Ersatz für eine Entfristung sein es natürlich nicht sein.
Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Außeruniversitäre Einrichtungen jenseits der Ressortforschung sind oft für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler attraktiv, die hoch kompetitive, zeitlich befristete Drittmittel wie etwa ERC-Grants oder Emmy-Noether-Gruppen eingeworben haben und sich aussuchen können, an welcher Institution sie diese ansiedeln. Sind diese Gruppen thematisch anschlussfähig, nehmen wir sie gerne auf, wohlwissend, dass wir die jeweiligen Themen langfristig nicht bearbeiten können. Entfristungen an außeruniversitären Einrichtungen beschränken sich daher meist auf Personen mit Langzeitaufgaben.
Welche Aufgaben wären das beispielsweise?
Am WZB gibt es große Datensätze, die kontinuierlich gepflegt werden müssen. Es gibt Themen, die wir im Verbund mit anderen Einrichtungen langfristig aufbauen wollen.
Wie sieht es bei den Hochschulen aus?
Entfristungen an Hochschulen lassen sich so einfach nicht bestimmen, oft gibt es auch große Unterschiede zwischen den Fachbereichen. In den letzten Jahren haben aber Tenure-Track-Professuren an Bedeutung gewonnen und werden weiter ausgebaut. Hier sehe ich deutliche Gestaltungsspielräume auch für die Außeruniversitären. In Berlin entwickeln wir gerade über den gesamten Berliner Forschungsraum hinweg ein System von Tenure-Tracks, bei dem Universitäten und Außeruniversitäre gemeinsam ausschreiben.
Prof. Dr. Jutta Allmendinger
Arbeitsbelastung und Gleichstellung: Unterschiede zwischen den Einrichtungsarten
Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Arbeitsbelastung?
In Ressortforschungseinrichtungen kann es zu kurzfristigen Anfragen durch das Ministerium oder die übergeordneten Dienststellen kommen, die Antworten müssen dann zwingend innerhalb kürzester Zeit vorliegen. Am IAB war ich oft schlicht darauf angewiesen, dass die jeweiligen Expertinnen und Experten dann mal zwei, drei Stunden länger im Haus blieben.
Dies kann durchaus auch an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen vorkommen. Grund sind dann aber weniger kurzfristige Anfragen, sondern eher Deadlines bei der Abgabe von Forschungsanträgen, Buchmanuskripten und Tätigkeitsberichten. Da die Karrierewege hier unsicherer sind und man sehr auf externe Rufe angewiesen ist, erachte ich die Arbeitsbelastung insgesamt in diesen Einrichtungen als deutlich höher.
Wie sieht es mit der Gleichstellung aus, gibt es da Unterschiede zwischen den Einrichtungsarten?
Bei der Gleichstellungspolitik innerhalb der Einrichtungen gibt es wohl kaum Unterschiede. Mittlerweile sind Gleichstellungsbeauftragte überall Pflicht und auch die Erstellung von Zielkorridoren im Frauenanteil. Interessanterweise zeigen sich aber deutliche Unterschiede, was die Leitung der Einrichtungen betrifft. An der Spitze von Hochschulen liegt der Frauenanteil bei 37 Prozent. Betrachtet man nur Neubesetzungen, liegt der Anteil noch höher. So machen in Berlin die weiblichen Neubesetzungen rund 53 Prozent aus. Hochschulen werden also viel häufiger als außeruniversitäre Einrichtungen und Ressortforschungseinrichtungen von Frauen geleitet, hier beträgt der Anteil knapp 25 Prozent.
Tipps für die Karriere in der Wissenschaft
Sie selbst führen aber eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung – unter anderem. Und das, obwohl zu Beginn Ihrer Wissenschaftskarriere Gleichstellung noch nicht den Stellenwert hatte, den sie heute hat. Haben Sie als Role Model Tipps für Nachwuchswissenschaftlerinnen oder auch Nachwuchswissenschaftler, wie eine akademische Karriere gelingen kann?
Einige Tipps habe ich schon. In der Promotionsphase ist es wichtig, engen Kontakt zu anderen Promovierenden und den Betreuerinnen und Betreuern zu halten. Es tut einfach gut, mit anderen zu sprechen, die in einer ähnlichen Lage sind. Und es wichtig, von den Betreuerinnen und Betreuern Rückmeldung zu erhalten, positive, aber auch kritische. Man hat das Recht und braucht den Mut, dies immer wieder einzufordern.
Dringend empfehle ich auch, sich schon in dieser Phase mit Fragen der Lehre und der Führung auseinanderzusetzen. Da schlittert man sonst rein und macht leicht unangenehme oder zeitfressende Erfahrungen, die man sich durch eine Weiterbildung hätte sparen können. Auch an den Aufbau von Netzwerken ist zu denken. Ich habe mich während meiner Dissertationsphase mit vielen Personen ausgetauscht, die zu ähnlichen Fragen arbeiteten, das hilft bis heute. Und ich konnte viel von den Netzwerken meiner Professoren profitieren, da ich immer an den kleinen Empfängen im Anschluss von Gastvorträgen teilnahm.
Am wichtigsten finde ich es aber, sich offen mit der weiteren Laufbahn zu beschäftigen. Trifft man wirklich informierte Entscheidungen? Will man wirklich in der Wissenschaft bleiben oder tut man das nur, weil man die anderen Sektoren nicht kennt? Es gibt Profil- und Kompetenztests, ich rate dringend, diese zu machen.
Auch wichtig: Man darf das Leben nicht vergessen. Wenn man Kinder möchte, sollte man nicht denken, dass es dafür den einen richtigen Zeitpunkt gibt.
Machen Sie den Test!
Sie sind unsicher, ob eine Promotion der richtige Weg für Sie ist? Finden Sie es heraus – mit dem gemeinsam mit Psycholog:innen entwickelten Promotions-Test von academics.