Physik Berufe
Was macht ein Physiker? Karriereperspektiven mit Physikstudium
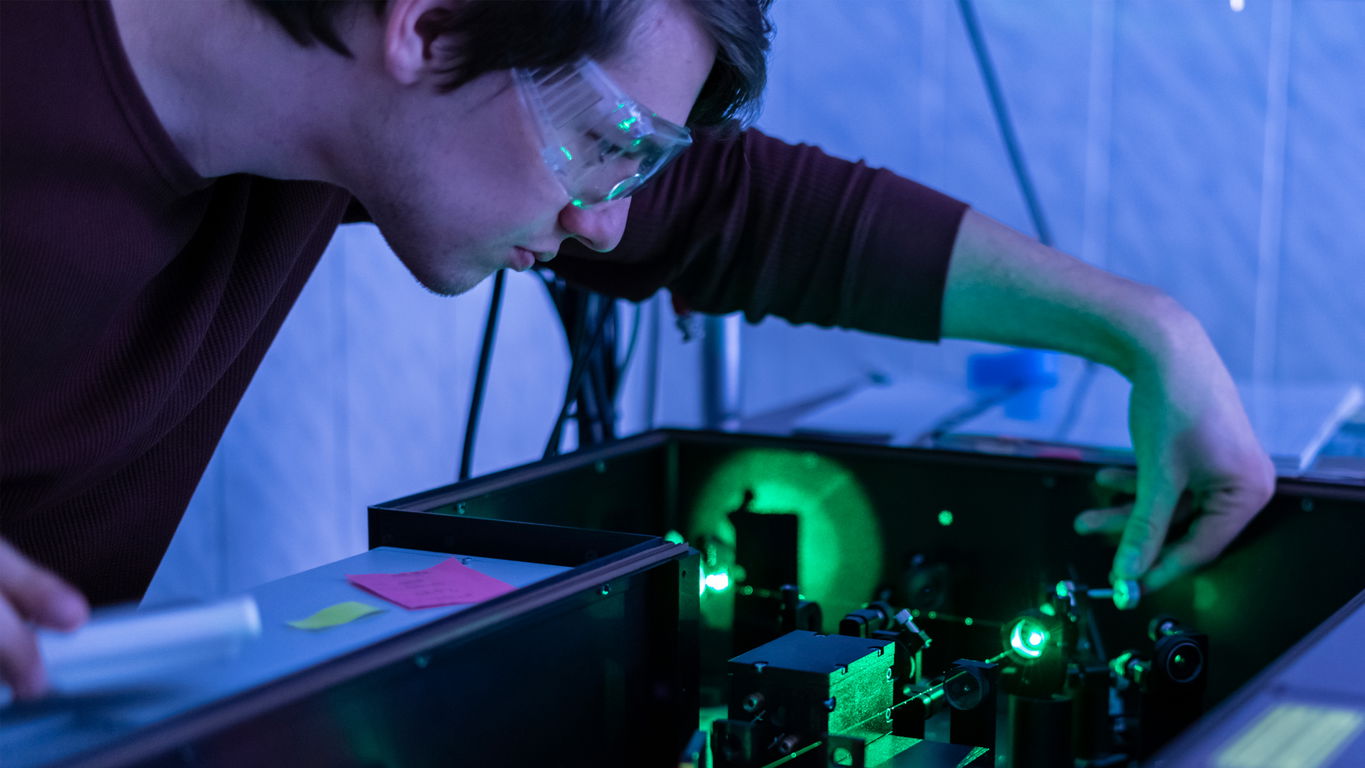
Wer Physik studiert, hat beste Jobaussichten © Михаил Руденко / iStock
Wer Physik studiert, kann auf ein weites Berufsfeld zurückgreifen und hat beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Welche Möglichkeiten Physikern und Physikerinnen offenstehen, erfahren Sie hier.
Aktualisiert: 17.05.2024
Definition: Physik und ihre Teilgebiete
Die Physik beschäftigt sich mit den Vorgängen der – in der Regel – unbelebten Natur und ihrer mathematischen Beschreibung und erklärt Phänomene von Energie und Materie. Sie gliedert sich in verschiedene Teilgebiete, wobei heute meist zwischen der klassischen Physik der letzten Jahrhunderte und der modernen Physik (ab dem 20. Jahrhundert) unterschieden wird. Zu den klassischen Gebieten der Physik zählen:
- die Mechanik,
- die Wärmelehre oder Thermodynamik,
- die Elektrizitätslehre oder Elektrik,
- die Optik sowie
- die Akustik.
Die moderne Physik basiert auf Theorien wie der Quanten-, Relativitäts- oder Chaostheorie und umfasst folgende Bereiche, in denen aktuell geforscht wird. Diese sind allerdings nicht in Stein gemeißelt, über die exakte Gliederung lässt sich vortrefflich streiten. Es handelt sich um
- die Festkörperphysik,
- die Atom- und Molekularphysik,
- die Teilchen- und Kernphysik,
- die Astrophysik sowie
- die Theoretische Physik.
Zudem gibt es innovative interdisziplinäre Bereiche, in denen aus verschiedenen Richtungen geforscht wird, beispielsweise die Biophysik oder die Medizinphysik.
Was macht ein Physiker oder eine Physikerin?
In Deutschland gibt es laut der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) rund 120.000 erwerbstätige Physiker und Physikerinnen, jene mit Lehramtsabschluss nicht eingeschlossen. Sie sind in den unterschiedlichsten Branchen und Berufen tätig. Teils forschen die Physiker:innen, teils setzen sie ihre physikalischen Kenntnisse in die angewandte Praxis um, um neue Lösungen für technische Herausforderungen zu schaffen. Oft arbeiten sie aber auch in Unternehmensberatungen, Banken und Versicherungen, der IT oder im Management.
Physik hat keine eigene Branche, das Berufsfeld ist nicht wie bei vielen anderen akademischen Ausbildungen klar eingegrenzt – insofern studieren angehende Physiker:innen das Fach in der Regel aufgrund eines intrinsischen Interesses an den Themenfeldern und weniger mit dem Hintergrund eines konkreten Berufswunsches.
Nach Abschluss des Studiums und gegebenenfalls der Promotion landen rund 70 Prozent der Physiker:innen in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung,15 Prozent arbeiten als Lehrer:innen (darunter auch Quereinsteigende) und 15 Prozent bleiben in der Wissenschaft. Die Gehaltsaussichten für Physiker:innen sind dabei in allen Berufsfeldern grundsätzlich sehr gut.
Wo arbeiten Physiker und Physikerinnen?
Physiker:innen Industrie, Wirtschaft und Verwaltung halten vielfältige Jobs bereit, die gern mit Physiker:innen besetzt werden. Sie arbeiten beispielsweise in der Produktentwicklung, im technischen Vertrieb oder im Sachverständigenwesen. Prinzipiell sind sie für viele Jobs geeignet, die auch mit Ingenieurinnen und Ingenieuren besetzt werden können. Darüber hinaus sind Physiker:innen dafür prädestiniert, mit neuen, kreativen Ideen komplexe Sachverhalte zu lösen.
Arbeitgeber und Aufgaben für Physiker:innen
Folgende Aufgabenfelder gehören zu denen, die Physiker:innen häufig bearbeiten:
- In erster Linie arbeiten Physiker:innen im Bereich Forschung und Entwicklung, auf etwa 45 Prozent trifft das nach DPG-Angaben zu. Gerade für Berufseinsteigende ist dieser Bereich naheliegend, da er direkt an die im Studium und gegebenenfalls in der Promotion erlernten Fähigkeiten anknüpft. 41 Prozent der Physiker:innen arbeiten in diesem Bereich in der High-Tech-, Maschinenbau- und Automobilindustrie, 42 Prozent sind im Bereich Telekommunikation, EDV oder IT tätig. Die übrigen 17 Prozent verteilen sich auf andere Branchen.
- Rund 17 Prozent der Physiker:innen in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung arbeiten als IT-Experten und Data Scientists.
- Rund neun Prozent sind im Top-Management angesiedelt. Hier handelt es sich in erster Linie um erfahrene Arbeitskräfte jenseits der 40.
- Etwa fünf Prozent haben sich als Firmengründer:innen mit Angestellten selbstständig gemacht.
- Rund fünf Prozent der Physiker:innen arbeiten in einer Unternehmensberatung.
- Etwa vier Prozent sind in der öffentlichen Verwaltung tätig.
- Die übrigen 15 Prozent der Physiker:innen in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung verteilen sich auf Berufe wie Wissenschaftsjournalisten, Patentanwälte, Medizinphysiker und andere.
Physiker:innen im öffentlichen Dienst
Ob Regierungsbehörde oder kommunale Verwaltung: Die Energiewende bringt viele Perspektiven für Physiker:innen bei öffentlichen Arbeitgebern mit sich. Mögliche Aufgaben:
- Sie können als Berater/innen für Regierungsstellen arbeiten, die sich mit Wissenschafts- und Technologiepolitik befassen. Sie können auch in politischen Organisationen arbeiten, um wissenschaftliche Erkenntnisse in politische Entscheidungsprozesse einzubringen. Auch die Entwicklung von Normen, Vorschriften und Richtlinien in Sektoren wie Energie, Umwelt, Gesundheit oder Telekommunikation kann ein Arbeitsfeld sein.
- Physikerinnen und Physiker können in öffentlichen Einrichtungen arbeiten, die sich mit der Entwicklung und dem Management von Technologien befassen, z. B. in der Raumfahrtbehörde, in der Verteidigungsindustrie oder in nationalen Forschungseinrichtungen.
- Behörden, die sich mit Umwelt- und Klimaforschung befassen, sind ebenfalls mögliche Arbeitsplätze. Physiker:innen können an Projekten zur Überwachung der Umweltverschmutzung, zur Modellierung des Klimawandels und zur Entwicklung nachhaltiger Energien beteiligt sein.
- In öffentlichen Gesundheitseinrichtungen oder Krankenhäusern können Medizinphysiker:innen medizinische Bildgebungstechnologien entwickeln und verbessern, Strahlentherapiegeräte kalibrieren oder an Forschungsprojekten im Gesundheitswesen mitwirken. Dazu ist eine entsprechende Spezialisierung nötig.
- In kommunalen Verwaltungen oder auch Landes- oder Bundesbehörden sind Physiker:innen gefragte Expert:innen, die sich mit Energiepolitik und -management befassen. Sie können an der Entwicklung von Energiestrategien, der Förderung erneuerbarer Energien oder der Optimierung des Energieverbrauchs beteiligt sein (Klimaschutzmanagement).
Physiker:innen in der Wissenschaft
Physiker:innen, die in der Wissenschaft bleiben, arbeiten entweder an Hochschulen oder an außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Arbeitgeber sind Universitäten, Fachhochschulen bzw. HAWs, die großen Forschungsgesellschaften wie beispielsweise die Helmholtz-Gemeinschaft, die Fraunhofergesellschaft oder die Max-Planck-Gesellschaft oder auch kleinere Einrichtungen wie zum Beispiel die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) oder die Bundesanstalt für Materialforschung- und prüfung (BAM). Jobs werden hier für wissenschaftliche Mitarbeiter:innen, (Promotionsstellen, Postdocs etc.), Nachwuchsgruppenleiter:innen oder als Professur ausgeschrieben.
Physiker oder Physikerin werden: Die Voraussetzungen
Wer als Physiker:in arbeiten möchte, muss ein Studium an einer Universität oder auch an einer Fachhochschule (FH) bzw. Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) absolviert haben. Zugangsbeschränkungen zum Studium wie einen Numerus clausus gibt es in der Regel nicht.
Theoretisch qualifiziert ein Bachelorabschluss bereits für bestimmte Tätigkeiten wie beispielsweise eine Laborassistenz, doch in der Praxis ist mindestens ein Abschluss auf Masterniveau die Regel. Laut DPG ist die Promotionsquote in den vergangenen zehn Jahren von 40 auf rund 60 Prozent gestiegen. Darin sind etwa 30 Prozent ausländische Promovierende enthalten. In der Forschung ist ein Doktortitel obligatorisch, in allen anderen Bereichen müssen angehende Physiker:innen jedoch nicht zwingend promovieren.
Abgesehen vom Studienabschluss sind – wie in allen Naturwissenschaften – ein mathematisches Grundverständnis sowie umfangreiche Englischkenntnisse unabdingbar, um Physiker:in zu werden, da sowohl Studieninhalte als auch Forschungsarbeiten auf Englisch verfasst werden. Zu den benötigten Soft Skills zählen Analyse- und Problemlösungskompetenz, Integrationsbereitschaft, die Fähigkeit, im Team zu arbeiten sowie eine gewisse Neugier als intrinsische Motivation.
Berufsaussichten und Gehalt für Physiker:innen
Unter Physik-Absolvent:innen herrscht quasi Vollbeschäftigung: Die Arbeitslosenquote lag 2023 nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bei 2,3 Prozent. Bei steigender Nachfrage: Die Anzahl neuer Stellen lag im selben Jahr um zehn Prozent höher als im Vorjahr. Auch Physiker:innen ohne Doktortitel mit einem Abschluss auf Masterniveau finden in der Regel problemlos eine Arbeitsstelle.
Durch die erste Welle der Coronapandemie stieg die Arbeitslosigkeit zwar erwartungsgemäß, blieb aber weiterhin unter dem Stand von Anfang 2018. Betroffen davon waren im Wesentlichen die Berufsanfänger:innen, während die 35- bis 55-Jährigen von der Krise kaum etwas gespürt haben. Inzwischen liegt die Zahl der Arbeitslosen wieder auf Vorkrisenniveau. Perspektivisch werden die Jobaussichten für Physik-Absolvent:innen laut DPG noch besser, da der Fachkräftemangel in dem Bereich weiter zunehmen und durch geburtenschwache Jahrgänge weiter verstärkt werden wird.
Besonders gefragt sind Physiker:innen heutzutage im Bereich Data Science, der in vielen Unternehmen und auch in der Forschung einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Gerade Teilchen- und Astrophysiker:innen sind für solche Aufgaben prädestiniert. Auch das Thema Quantencomputing gewinnt in der Industrie an Bedeutung, hier sind vor allem Physiker:innen aus der Festkörperphysik, Quantenoptik sowie Quantenphotonik gefragt. Auch die recht junge Life Science Branche hält Arbeitsplätze für Physiker:innen parat.
Die überwiegend komplexen Tätigkeiten von Physikern und Physikerinnen sowie der hohe Bedarf wirken sich positiv auf den Verdienst aus. Einstiegsgehälter liegen im Schnitt bei über 50.000 Euro brutto im Jahr, im Laufe des Berufslebens steigt das Einkommen in der Regel noch deutlich an. Schon nach zehn Jahren Berufserfahrung können Physiker:innen mit knapp 70.000 Euro im Durchschnitt rechnen. Detaillierte Zahlen hält der Artikel „Was Physiker verdienen: Gehalt und Einflussfaktoren“ bereit.








