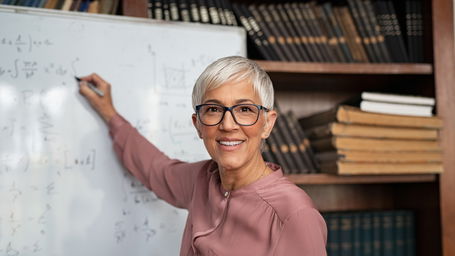Wie wird man Professor?
Die Voraussetzungen für eine Professur

Unter welchen Vorraussetzungen kann ich Professor werden? © Clerkenwell / istockphoto.com
Es ist die Krönung einer Karriere in der Wissenschaft: die Stelle als Professorin oder Professor an einer Hochschule. Wie wird man Professor:in? Welche Voraussetzungen gibt es für eine Berufung? Ein Überblick.
Aktualisiert: 31.12.2024
Professor werden: Das Wichtigste in Kürze
Die Voraussetzungen für eine ordentliche Universitätsprofessur sind:
- Absolviertes Hochschulstudium
- Promotion: Erwerben eines Doktortitels in einem Fachgebiet
- Habilitation: Erlangen einer Lehrbefähigung in einem wissenschaftlichen Fach oder alternativ eine gleichwertige Qualifikation wie beispielsweise eine positiv evaluierte Juniorprofessur oder Nachwuchsgruppenleitung
- Berufung: Erfolgreiche Bewerbung auf freie Professorenstellen
Für eine HAW-Professur ist eine Habilitation keine Voraussetzung; neben dem Doktortitel und Lehrerfahrung müssen Bewerber:innen aber eine mehrjährige Berufspraxis außerhalb der Hochschule nachweisen können. An Musik- und Kunsthochschulen sind herausragende künstlerische Leistungen Voraussetzung für eine Professur.
Voraussetzungen für eine Professur: Wo ist das geregelt?
Welche Bedingungen muss ich erfüllen, wenn mein Berufsziel Professorin oder Professor ist? Wer sich diese Frage stellt, wird im Landeshochschulgesetz des jeweiligen Bundeslandes – in dem die Hochschule liegt – fündig. Die Gesetzgebungskompetenz im Kultusbereich in Deutschland ist Ländersache. Also regelt jedes Bundesland den Bereich Hochschule, zu dem auch die Zugangsvoraussetzungen zum Professorenberuf gehören, selbst.
Doch keine Sorge: Wer noch nicht weiß, an welche Hochschule er oder sie eines Tages berufen werden könnte, kann dennoch vorplanen. Die meisten Voraussetzungen sind in den Bundesländern sehr ähnlich. Die Landeshochschulgesetze finden sich in der Aufstellung der Kultusminister-Konferenz.
Dienstrechtliche Voraussetzungen
In nahezu allen Landeshochschulgesetzen befindet sich am Anfang die gleichlautende Formulierung: „Einstellungsvoraussetzungen für Professoren sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen…“. Was ist darunter zu verstehen? Hier geht es um die Einstellung eines Professors oder einer Professorin im Beamtenverhältnis, was der Normalfall ist. Deshalb müssen die Vorgaben des Beamtenstatusgesetzes berücksichtigt werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Bewerber oder die Bewerberin „die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten“. Mehr zu den Voraussetzungen für eine Verbeamtung lesen Sie hier.
Daneben wird meist ein Gesundheits- und ein Führungszeugnis fällig. Bei den Angaben zur Nationalität (Bewerbende müssen grundsätzlich mindestens aus Ländern stammen, mit denen es ein Abkommen zur Anerkennung von Qualifikationen gibt), gibt es ausdrücklich Ausnahmen für Hochschullehrer:innen. Sie können auch aus anderen Staaten in das Beamtenverhältnis berufen werden, wenn „andere wichtige Gründe“ vorliegen.
Auch das Alter zählt im weiteren Sinn zu den dienstlichen Voraussetzungen, denn bei der für Professor:innen vorgesehenen Verbeamtung gibt es Höchstgrenzen. Je nach Bundesland unterscheidet sich die Altersgrenze, in den meisten Ländern beträgt sie 50 bis 55 Jahre. Oft gibt es jedoch Ausnahmen, zum Beispiel wenn Betreuungszeiten angerechnet werden, der Kandidat oder die Kandidatin schon verbeamtet ist oder ein:e Minister:in zustimmt.
Hochschulstudium ist erforderlich
Die wichtigste und immer an erster Stelle genannte Voraussetzung für eine Professur ist ein Studium. Es muss an einer Hochschule absolviert und abgeschlossen sein. Schleswig-Holstein präzisiert außerdem, dass es sich um „ein zum Zugang für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt berechtigendes“ Studium handeln muss. Hier handelt es sich zum Beispiel um einen Master, ein Bachelorabschluss ist oft nicht ausreichend. In aller Regel ist auch eine Promotion eine zwingende Voraussetzung für einen Lehrstuhl.
Pädagogische Eignung: Lehrerfahrungen nachweisen
Wer als Professor:in lehren möchte, muss nachweisen, dass er über die dafür nötige pädagogische Eignung verfügt. Für die Bewerbung um eine Professur ist es also essentiell, diese darzulegen. Erwerben bzw. nachweisen lässt sich die didaktische Eignung durch
- eine Auflistung selbstständig durchgeführter Lehrveranstaltungen, etwa als Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Privatdozentin, Lehrbeauftragter oder in einer Vertretungsprofessur
- die Teilnahme an Fort- oder Weiterbildungen in Hochschuldidaktik
- das Abhalten einer Probelehrveranstaltung im Rahmen des Berufungsverfahrens. Das Thema der meist 45- bis 90-minütigen Lehrprobe wird in der Regel von der Berufungskommission festgelegt. Manchmal muss der Bewerber oder die Bewerberin eine zweite Probevorlesung abhalten, deren Thema dann frei wählbar ist.
Die Darlegung der abgehaltenen Lehrveranstaltungen sollte möglichst detailliert erfolgen: Wann und wo wurde gelehrt, was war das Thema der Vorlesung oder Seminare, welchen Umfang hatten diese?
Forschungserfahrung: So gelingt der Nachweis
Eine Professur beinhaltet nicht nur die Lehre, sondern auch die Forschung. Wer sich um eine vakante Stelle bewerben möchte, muss also nachweisen, dass er oder sie über ein hohes Maß an – möglichst internationaler – Forschungserfahrung verfügt. Dieser Nachweis kann erbracht werden über
- eine detaillierte Auflistung der Forschungsprojekte im In- und Ausland an Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen, an denen der Anwärter oder die Anwärterin mitgearbeitet hat
- die Publikationsliste, die den Bewerbungsunterlagen zwingend beizufügen ist. Welche Publikationen hat der oder die Bewerbende vorzuweisen, wo wurden sie veröffentlicht, wie groß ist bei Ko-Autorenschaft der Anteil, der beigesteuert wurde?
Die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Arbeit ist ein Muss
Ein zentraler Aspekt der Einstellungsvoraussetzungen sind auch die „besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit“. Diese wird „in der Regel durch die Qualität einer Promotion“ nachgewiesen (siehe z.B. recht.nrw.de). Zwei Länder gehen dabei noch weiter und setzen die „gute Qualität einer Promotion“ (Schleswig-Holstein) bzw. eine „überdurchschnittliche Promotion“ (Niedersachsen) voraus.
Durch die Formulierung „in der Regel“ wird aber auch deutlich, dass die Promotion nicht zwingend Voraussetzung ist, um Professor:in werden zu dürfen. Hamburg beispielsweise weist explizit darauf hin, dass diese Voraussetzung auch durch eine „gleichwertige wissenschaftliche Leistung“ erfüllt werden kann. Auch Hessen tut das, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass in einigen Fachbereichen Promotionen nicht üblich sind. Während gerade Universitäten in den meisten Fällen einen Doktortitel bei der Berufung auf einen Lehrstuhl verlangen, ist an Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften oft die praktische Erfahrung wichtiger (siehe den Abschnitt „Fachspezifische Voraussetzungen für Professuren“).
Die Zeit nach der Promotion (die sogenannte „Postdoc-Phase“) für zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zu nutzen, ist deshalb sehr sinnvoll investiert. Deren Anzahl kann bei der Berufung in ein Professorenamt als „wissenschaftliche Währung“ den Ausschlag geben.
Zusätzliche Leistungen als Bedingung für Professor:innen
Doch Hochschulen wollen nicht nur sicherstellen, dass ihre Professor:innen wissenschaftlich arbeiten können. Da sie ihr Renommee vor allem durch die Leistungen der Wissenschaftler:innen beziehen, wollen sie wissen, ob die Kandidierenden für einen Lehrstuhl auch bisher schon Herausragendes geleistet haben. Diese Leistungen können Wissenschaftler:innen auf mehreren Wegen beweisen:
- in der Regel im Rahmen einer Juniorprofessur/Gruppenleitung oder durch eine Habilitation
- durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen als wissenschaftliche Mitarbeitende an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung
- oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in der Wirtschaft bzw. in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- oder Ausland
Rheinland-Pfalz nennt an dieser Stelle auch den „Tenure Track“ als Ausdruck der wissenschaftlichen Leistungen. Dies ist seit 2002 eine besondere Ausgestaltung der Juniorprofessur, die schon bei der Besetzung den Übergang in eine Lebenszeitprofessur zusagt. In diesem Fall ist die Erbringung der wissenschaftlichen Leistungen im Rahmen der höchstens sechsjährigen Beschäftigungsphase möglich.
Die Qualität der Leistungen wird dann letztendlich von der betreffenden Hochschule im Berufungsverfahren bewertet. Schleswig-Holstein fordert von seinen zukünftigen Professor:innen außerdem, dass sie mindestens zwei Jahre an einer anderen Hochschule oder Forschungseinrichtung wissenschaftlich gearbeitet haben. Sachsen-Anhalt erweist sich bei der Erbringung dieser Voraussetzung sozial und berücksichtigt bei den Leistungen Mutterschutz-, Kindererziehungs-, und Pflegezeiten.
In vielen Fachbereichen spielt auch die Einwerbung von Drittmitteln zur Unterstützung der Forschung eine große Rolle. Wer hier während seiner Postdoc-Phase erfolgreich Anträge – zum Beispiel an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – formuliert und Mittel eingeworben hat, erhöht an den entsprechenden Instituten seine Chancen.
Fachspezifische Voraussetzungen für Professuren
In einigen Fachbereichen müssen Bewerber:innen zusätzliche Qualifikationen nachweisen: Für pädagogische, künstlerische oder medizinische Professuren sind genau wie für Professuren an Fachhochschulen/HAWs praktische Erfahrungen vonnöten.
Voraussetzungen für pädagogische Professuren
Für Professuren mit erziehungswissenschaftlichen oder fachdidaktischen Aufgaben in der Lehrerbildung fordern die Bundesländer fast einhellig mindestens drei Jahre Erfahrung als Lehrer:in an einer Schule. Es gibt nur einige Ausnahmen:
- Niedersachsen: Drei Jahre Schule ODER Erfahrung in der empirischen Forschung, die den Aufgaben der angestrebten Professur entspricht
- Sachsen-Anhalt: Drei Jahre Schule ODER empirische Forschung, aber nur, wenn innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Berufung ausreichende Berufspraxis nachgewiesen werden kann
- Saarland: Drei Jahre Schule ODER Forschung zu schulpraktischen Fragen
- Mecklenburg-Vorpommern: Drei Jahre Schule UND eine Zweite Staatsprüfung oder gleichwertige Qualifikation
Voraussetzungen für künstlerische Professuren
Für Professor:innen in künstlerischen Fachrichtungen gilt (analog zu den oben beschriebenen wissenschaftlichen Fähigkeiten/Leistungen): Sie müssen nachweisen, dass sie fähig sind, künstlerisch zu arbeiten und künstlerische Leistungen erbracht haben. Hier wird in den meisten Bundesländern Wert darauf gelegt, dass es sich dabei um eine mehrjährige künstlerische Tätigkeit handelt, die auch außerhalb der Hochschule erfolgreich und mit herausragenden Leistungen absolviert wurde.
Voraussetzungen für medizinische Professuren
Professor:innen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben brauchen zusätzlich die Anerkennung als Facharzt oder Fachärztin und in den meisten Ländern auch als Gebietsarzt in ihrem Fachgebiet, bzw. müssen eine von der jeweiligen Kammer gleichwertig empfundene Weiterbildung gemacht haben. Für Bereiche, in denen spezielle Facharztausbildungen nicht üblich sind, kann die fünfjährige praktische Tätigkeit im jeweiligen Gebiet angerechnet werden.
Voraussetzungen für HAW-/FH-Professuren
Wer einen Lehrstuhl an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder an einer Dualen Hochschule oder Fachhochschule ergattern will, kann in einigen Fällen zwar auf Promotion und Habilitation verzichten, muss aber Praxiserfahrung nachweisen: Hier werden „besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden“ verlangt.
Voraussetzung ist in der Regel, dass die zukünftigen Professor:innen fünf Jahre Berufspraxis haben, von denen sie mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs tätig waren. Wer einen Lehrstuhl an eine FH/HAW anstrebt, überlegt sich am besten schon recht frühzeitig, welche Fachgebiete in Frage kommen würden: Da die meisten Professuren praktische Erfahrung auf dem Gebiet des Lehrstuhls fordern, kann man so seine beruflichen Stationen danach auswählen.