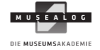Karrierewege nach der Promotion
Nach der Promotion – welche Optionen gibt es?

© Janis Abolins / iStock.com
Der Doktortitel ist erreicht. Wie geht es weiter? Lesen Sie hier, welche Karriereoptionen Promovierte in der Wissenschaft, dem öffentlichen Dienst oder der Wirtschaft haben.
Aktualisiert: 21.05.2025
Karrierewege: Was kommt nach der Promotion?
Endlich geschafft: Die Promotion ist abgeschlossen und die Dissertation wurde veröffentlicht. Jahrelang hat diese Arbeit gedauert, Höhen und Tiefen wurden durchlebt, aufgeben kam nicht infrage. Nun steht mit Fug und Recht der Doktortitel vor dem Namen. Ein gutes Gefühl. Doch spätestens nach der ersten Erleichterung stellt sich oft die Frage: Was nun? Der „Bundesbericht Wissenschaftler und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen 2025“ (BuWiK) zeigt:
- Die Arbeitslosigkeit von Promovierten liegt ab dem dritten Jahr bis zum siebten Jahr nach der Promotion kontinuierlich bei etwa ein bis zwei Prozent. Damit ist ein hohes Maß an Vollbeschäftigung erreicht.
- 24 Prozent der Promovierten arbeiten langfristig im Wissenschaftssystem.
- 48 Prozent arbeiten sieben Jahre nach der Promotion in der privaten Wirtschaft.
- 24 Prozent arbeiten in Krankenhäusern und Arztpraxen.
- 4 Prozent im sonstigen öffentlichen Dienst.
Postdoc in der Wissenschaft
Die Professur ist die Krönung einer universitären Karriere. Wer diese Erfolgsstufe erreicht hat, genießt die größtmögliche Selbstständigkeit in Lehre und Forschung. Hinzu kommt meist ein unbefristeter Beamtenstatus mit gutem Gehalt: Ein:e W3-Professor:in verdient je nach Arbeitgeber zwischen ca. 7.300 bis 9.150 Euro brutto monatlich – plus Zulagen. Doch der Weg zur Professur ist lang: So sind Wissenschaftler:innen im Schnitt 41 Jahre alt, wenn sie zum ersten Mal zum Professor oder zur Professorin berufen werden.
Hinzu kommt die Unsicherheit, ob die Mühe sich lohnt, denn die Chancen auf einen Lehrstuhl sind nur gering: Laut Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) ist die Postdoc-Phase auf sechs Jahre befristet (geplante Änderung: vier Jahre, optional zwei weitere), und wer dann keine unbefristete Stelle erhält, findet als zwar hochqualifizierte, jedoch sehr theoretisch ausgebildete Fachkraft häufig nur schwer einen Job außerhalb der Wissenschaft.
Wer Hochschullehrer oder Hochschullehrerin werden will, muss sich zunächst die Frage stellen, an welcher Institution: an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) oder Universität? Ein späterer Wechsel ist nicht so einfach und durchaus die Ausnahme – denn für die Arbeit an einer HAW ist vor allem praktische Berufserfahrung gefragt, an einer Universität liegt der Fokus indes auf Theorie und Forschung.
Ziel HAW-Professur – Zwischen Theorie und Praxis
Das zeigt sich auch an den jeweiligen Einstellungsvoraussetzungen: Für die Berufung zum Professor an einer HAW sind weder Habilitation noch ein spezielles Postdoc-Programm nötig. Hier zählen vielmehr praktische Erfahrungen. Der oder die Bewerber:in muss in der Regel mindestens fünf Jahre Berufserfahrung nachweisen, drei davon außerhalb der Hochschule – wer dieses Ziel anstrebt, sollte sich also (spätestens) nach der Promotion einen Job in der freien Wirtschaft suchen. Eine gute Alternative ist eine Industriepromotion, bei der berufliche Praxis und Forschung vereint werden.
Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die pädagogische Eignung, denn HAW-Professor:innen forschen deutlich weniger als die Kolleg:innen an Universitäten. Dadurch nimmt die Lehre an HAWs einen deutlich höheren Stellenwert ein. Für eine erfolgreiche Bewerbung an einer HAW ist es also von Vorteil, bereits als Dozent:in an einer Hochschule gearbeitet zu haben. Die Chancen auf eine Anstellung sind generell gut, denn HAW-Professor:innen werden vielerorts händeringend gesucht.
Ziel Universitätsprofessur – Schwerpunkt in Theorie und Forschung
Wer seinen Schwerpunkt nicht in der praktischen Arbeit, sondern in Forschung und Theorie sieht, ist an einer Universität besser aufgehoben. Der Weg zu einer Professur ist aber kein leichter. Oft gleicht er einer Ochsentour, geprägt von befristeten Anstellungen sowie harten Kämpfen um Publikationen und Forschungsgelder. Die Stellen sind rar, nur die Ehrgeizigsten kommen ans Ziel. Zunächst gilt es aber, die Voraussetzungen für eine Universitätsprofessur grundsätzlich zu erfüllen – dafür stehen in der Regel folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
- die Habilitation im Rahmen einer Anstellung als Wissenschaftlich Mitarbeitende:r oder Akademischer Rat bzw. Akademische Rätin
- die Juniorprofessur, ggf. mit Tenure Track
- die Nachwuchsgruppenleitung
Die Habilitation
Der klassische und wohl am häufigsten gewählte Weg zur Universitätsprofessur ist die Habilitation. Wissenschaftler:innen in frühen Karrierephasen arbeiten dabei vier bis sechs Jahre als Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen oder Akademische Rät:innen an Forschungsprojekten mit – befristet, verbeamtet oder angestellt – und verfassen eine Habilitationsschrift. Auch die forschende Industrie bietet Postdoc-Stellen, über die eine Habilitation erreichbar ist – falls die Möglichkeit der Publikation der dort erlangten Forschungsergebnisse besteht.
Akademischer Rat / Rätin: Stellenangebote
Die Juniorprofessur
Neben der Habilitation hat sich seit 2002 die Juniorprofessur auf dem Weg zur „richtigen“ Professur bewährt. Juniorprofessoren und -professorinnen können für die Dauer von bis zu sechs Jahren unabhängig forschen und sind berechtigt, Prüfungen abzunehmen. Eine erfolgreich abgeschlossene Juniorprofessur ist eine wichtige (aber nicht zwingende) Voraussetzung für die Berufung auf eine Professur. Eine Habilitationsschrift ist damit nicht mehr notwendig. Somit haben sie mehr Zeit für Publikationen und das Einwerben von Drittmitteln. Hiermit können sich die Juniorprofessoren zugleich schon früh auf dem Wissenschaftsmarkt positionieren.
Seit der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes 2002 bildet der Tenure Track einen möglichen Zusatz bei der Ausschreibung einer Juniorprofessur. Sie beinhaltet die generelle Zusage, nach erfolgreich absolvierter, befristeter Bewährungszeit eine Professur auf Lebenszeit zu erhalten, ganz ohne weitere Ausschreibung oder Berufungsverfahren.
Juniorprofessur Stellenangebote
Die Nachwuchsgruppenleitung
Die Leitung einer eigenen (Nachwuchs-)Forschungsgruppe ist ein äußerst vielversprechender und lohnenswerter Weg zur Professur. Denn: Nachwuchsgruppenleiter:innen können in der Regel (und im Gegensatz zu Juniorprofessor:innen) mehrere Jahre eigenständig forschen, und das weitestgehend weisungsungebunden. Sie müssen sich nicht um Fördergelder bemühen, sondern erhalten ein meist sehr großzügiges Budget und eine sehr gute Ausstattung. So haben sie die besten Voraussetzungen, sich für eine Professur zu qualifizieren.
Mit Doktortitel in den öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst werden Fachkräfte fast aller Fachbereiche händeringend gesucht. Das Gehalt ist tariflich geregelt und liegt somit zwar häufig unter denen in der freien Wirtschaft, jedoch ist es sicher und planbar. In hohen Führungspositionen sind sogar bis zu sechsstellige Verdienste möglich – und gerade Promovierte haben im öffentlichen Dienst sehr gute Chancen, einen Job mit Leitungsfunktion, zu bekommen. Unterhalb bestimmter Altersgrenzen ist für Quereinsteiger:innen eventuell sogar noch eine Verbeamtung möglich.
Diese Jobs könnten Sie interessieren
Nach der Promotion in die freie Wirtschaft
Promovierte haben auf dem freien Arbeitsmarkt hervorragende Aussichten. Jedoch bestehen Unterschiede zwischen den Fachbereichen: Eine Promotion in Ingenieurwissenschaften, in der Medizin oder in naturwissenschaftlichen Fächern geht in der freien Wirtschaft mit besseren Jobaussichten einher als beispielsweise eine Promotion in den Sprach- und Kulturwissenschaften.
Ein weiterer Lichtblick: Promovierte haben auch in der Industrie im Durchschnitt höhere Einkommen als Nichtpromovierte, der Unterschied des Bruttoeinkommens bei Vollzeittätigkeit fünf Jahre nach Abschluss liegt bei etwa 10.000 Euro im Jahr. Zudem nehmen Promovierte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Führungspositionen ein und sind eher adäquat beschäftigt als Beschäftigte ohne Doktortitel.
Während für Universitäten vor allem die akademische Laufbahn, die Publikationen und die fachliche Spezialisierung von Kandidat:innen im Vordergrund stehen, ist dies in der freien Wirtschaft häufig eher nachrangig. Hier sind praktische Erfahrungen gefragt; gerade große Unternehmen bieten aber entsprechende Trainee-Programme an, auch Tests in Assessment Centern sind üblich. Bewerber:innen sollten im Anschreiben bisherige Praxiserfahrungen aufführen und genau erläutern, wie er sich im Unternehmen einbringen könnte und welchen Nutzen das jeweilige Unternehmen durch die Einstellung hätte. Mehr hierzu im Bewerbungs-Ratgeber für Akademiker:innen.